|
|
|
||
| Cell Techniques and Applied Stem Cell Biology |
|||
|
|
|||
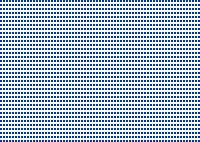 |
In vitro - Regeneration von artikulärem Knorpel im Bioreaktor und Reimplantation im Tiermodell zur Rekonstruktion irreparabler fokaler Knorpeldefekte
Zusammenfassung:
Die Behandlung (osteo)chondraler
Läsionen von Gelenkknorpel stellt aufgrund der geringen
Selbstheilungstendenz eine klinische und wissenschaftliche
Herausforderung dar. Eigene Untersuchungen auf dem Gebiet der
Kultivierung und Stimulierung von Knorpelzellkonstrukten in vitro
führten zur Entwicklung eines Mini-Bioreaktors, welcher in einen
GMP-geeigneten Bioreaktorkreislauf implementiert werden kann.
Ziel
des Projektes ist es, autolog gewonnenen Knorpel aus dem
Schafskniegelenk in vitro im Biorektor zu regenerieren und in
einem zweiten Schritt in einem generierten fokalen Knorpeldefekt zu
reimplantieren.
Nach 1, 3 und 6 Monaten werden die Kniegelenke
explantiert und mit der International Cartilage Repair Society-Klassifikation
(ICRS) für Knorpelregeneration histologisch analysiert. Die Studie
bildet die Grundlage zur Etablierung eines Knorpeldefektmodells am
Schafsknie, an dem in zukünftigen Projekten modifizierte
Knorpelkonstrukte und „Tissue - engineered“
Knochen-Knorpel-Konstrukte auf ihre Biokompabilität hin untersucht
werden sollen. Präklinische Studien am Großtiermodell unter
vergleichbaren Belastungen und ähnlichem operativen Aufwand wie am
Menschen sollen die Basis für die Anwendung im klinischen Bereich
legen. Therapie osteochondraler Defekte mittels biphasischer Konstrukte aus autologen vordifferenzierten Stammzellen versus osteochondraler autologer Transplantation (OAT) im Tiermodell
Zusammenfassung:
Die Therapie größerer osteochondraler
Defekte ist aufgrund fehlender Spontanheilung eineklinische und
wissenschaftliche Herausforderung. Beim derzeitigen klinischen
Goldstandard, der Transplantation
autologer osteochondraler Zylinder kommt
(OAT) es zu einer frühzeitigen Degeneration.
In einem zweiten Schritt erfolgt die
Implantation dieser Konstrukte in den nun
chronifizierten osteochondralen
Defekt. In der gleichen Operation wird auf der Gegenseite eine
klassische
osteochondrale Zylindertransplantation (OAT) zur Defektdeckung
durchgeführt. Die Explantation der Kniegelenke
erfolgt nach Standzeiten von 6
und 12 Monaten. Die Defektzonen werden mit der International Cartilage Repair Society-Klassifikation (ICRS) für Knorpelregeneration histologisch analysiert. Der Vergleich mit der Transplantation osteochondraler Zylinder lässt sich neben einer quantitativen auch eine qualitative Einschätzung der biphasischen Konstrukte vornehmen. Das Projekt bildet als Studie am Großtiermodell unter vergleichbaren Belastungen und ähnlichem operativen Aufwand wie am Menschen die Basis für die Anwendung von biphasischen osteochondralen Konstrukten auf Stammzellbasis im klinischen Bereich. |
|||||
|
|
|||||
| home |
|
Cell Techniques and Applied Stem Cell Biology, 29.08.2007 | |||
|
|
|||||











