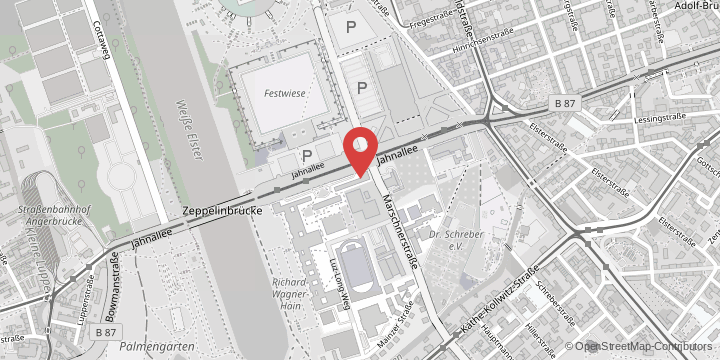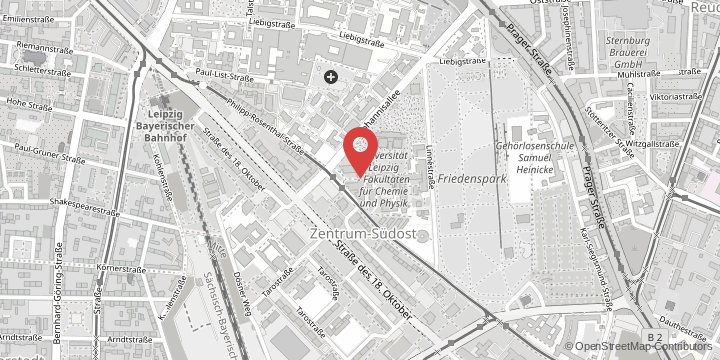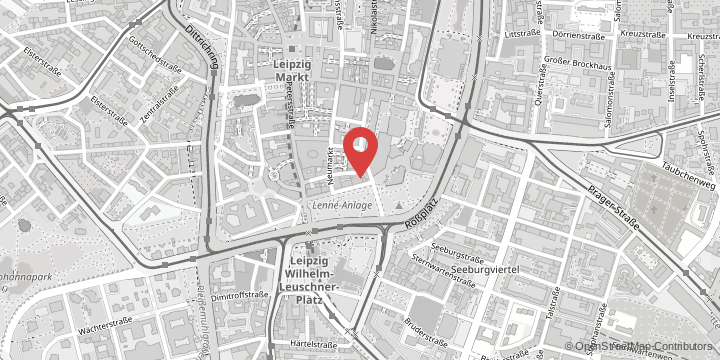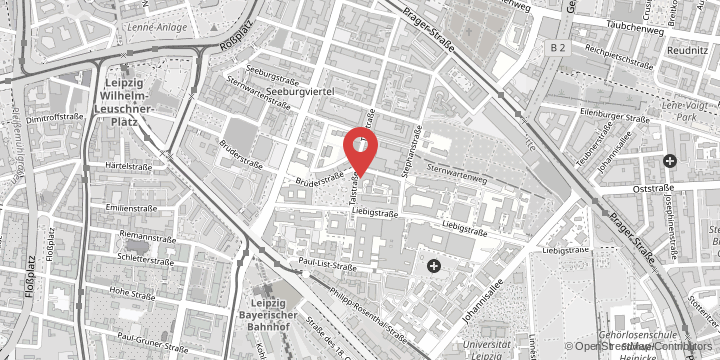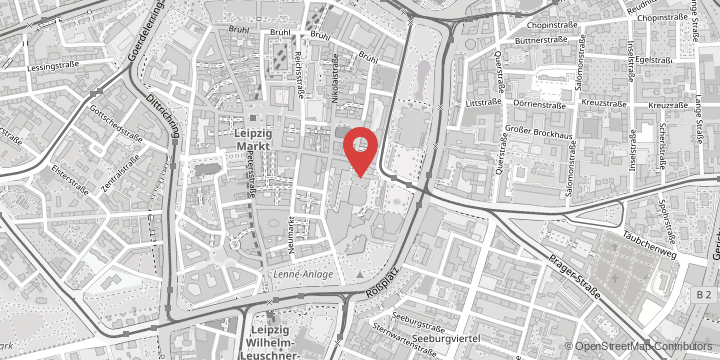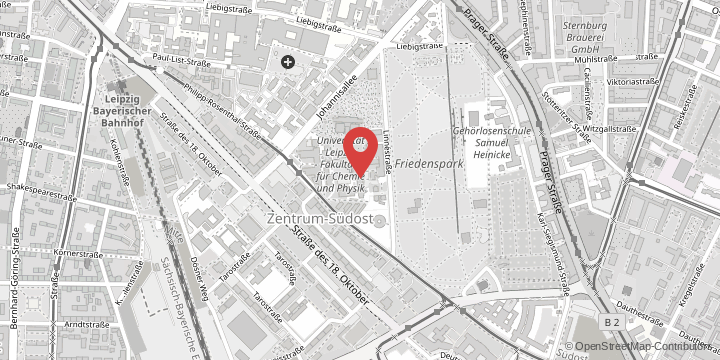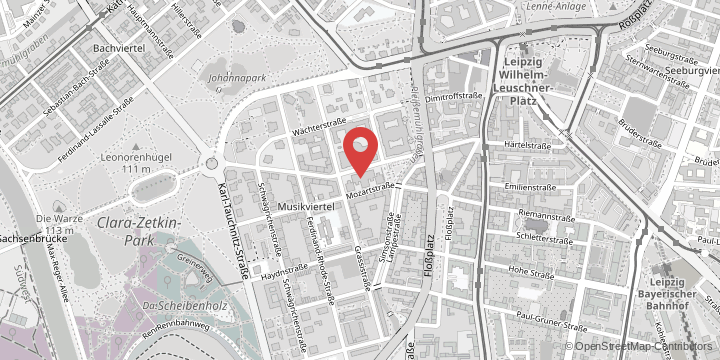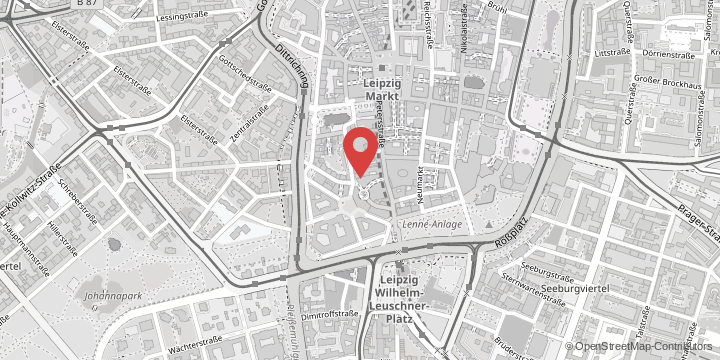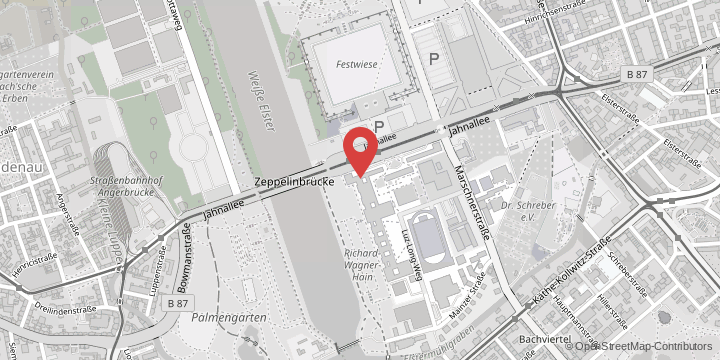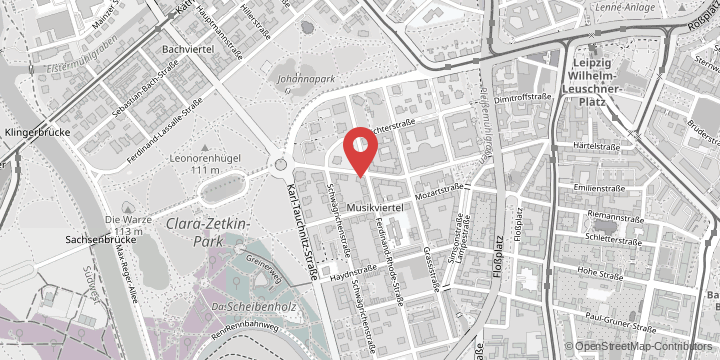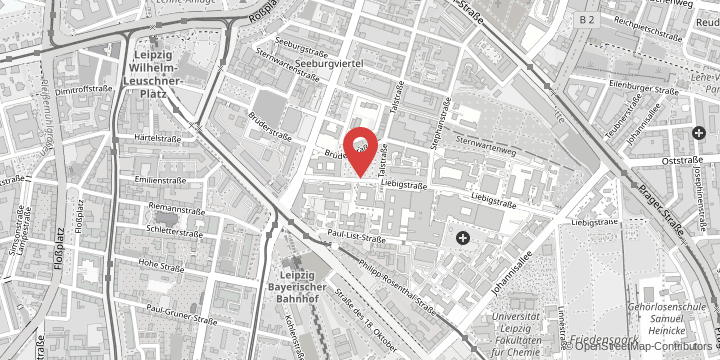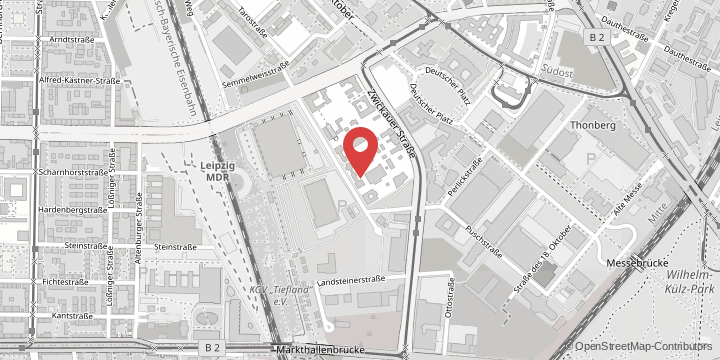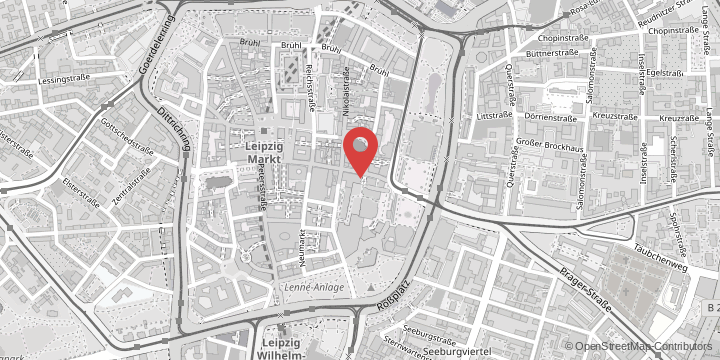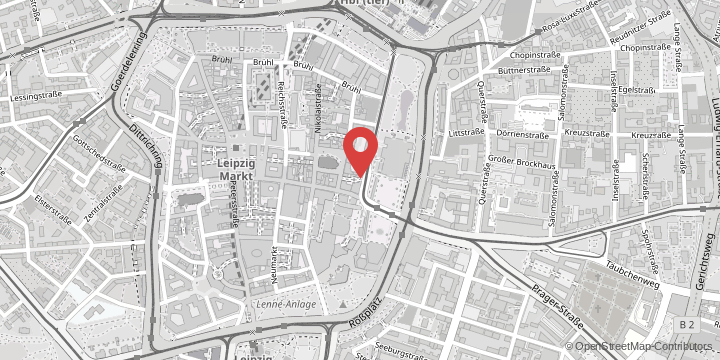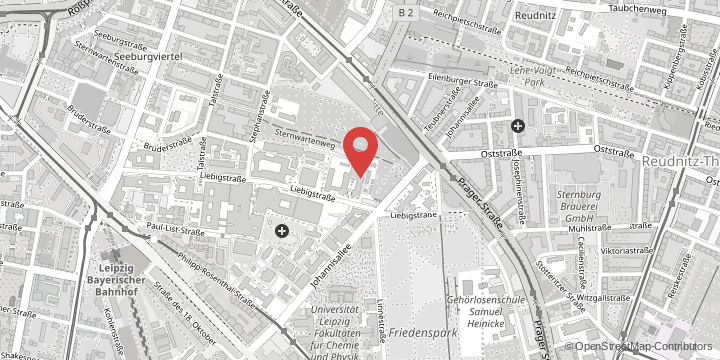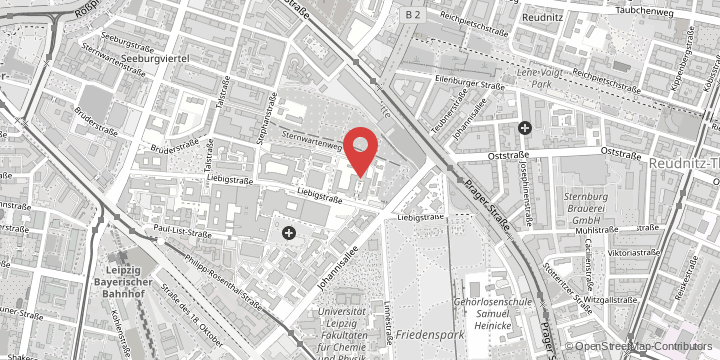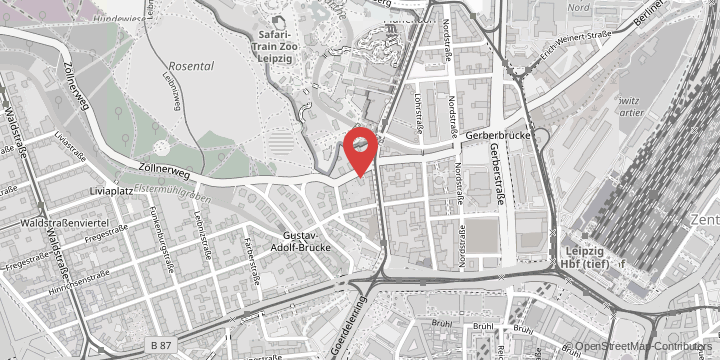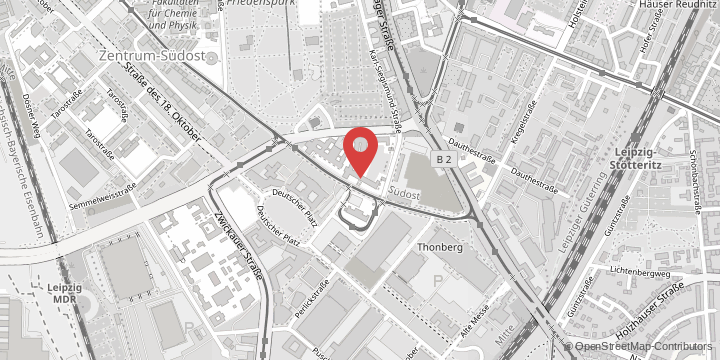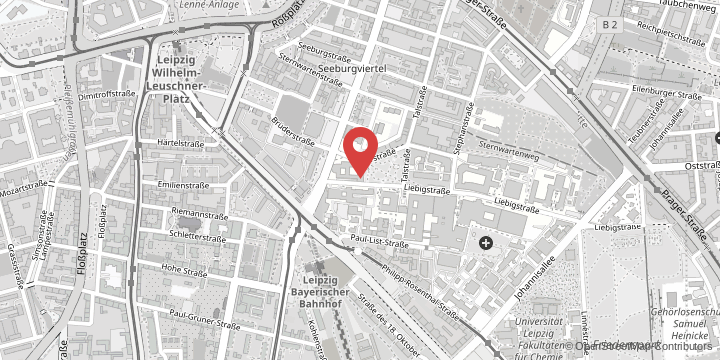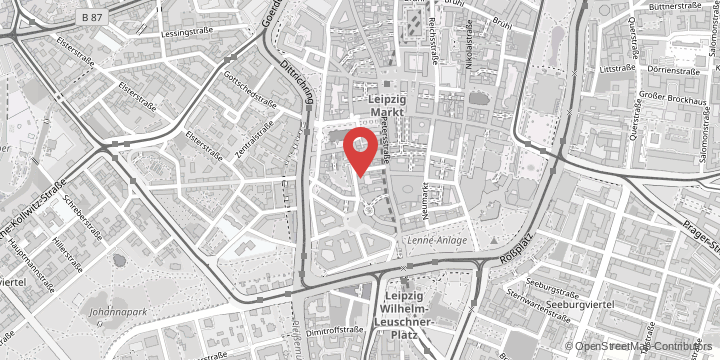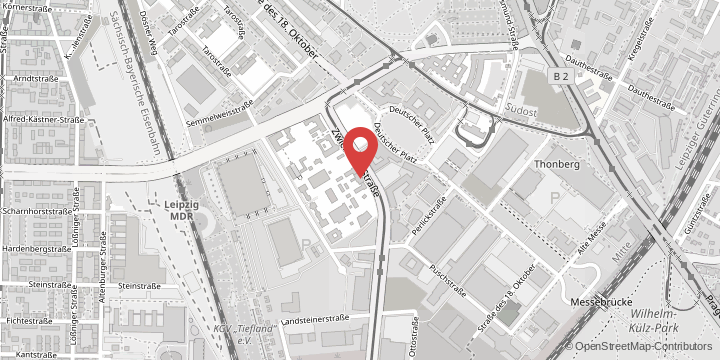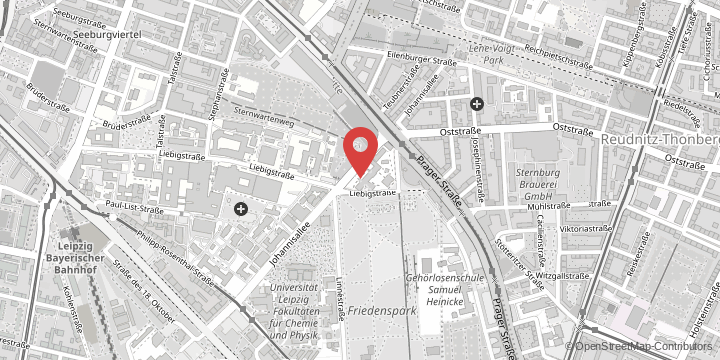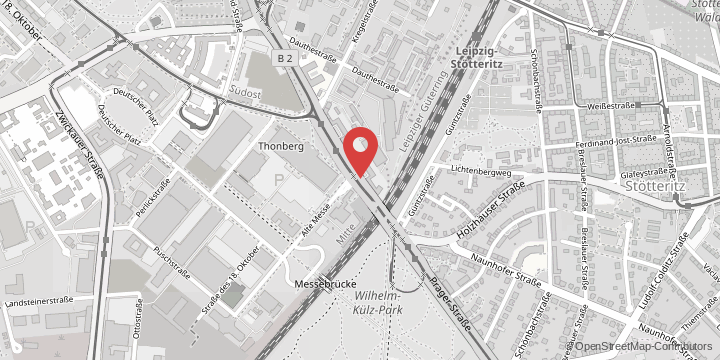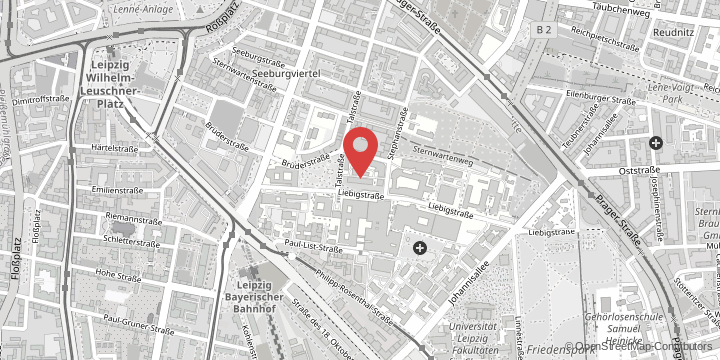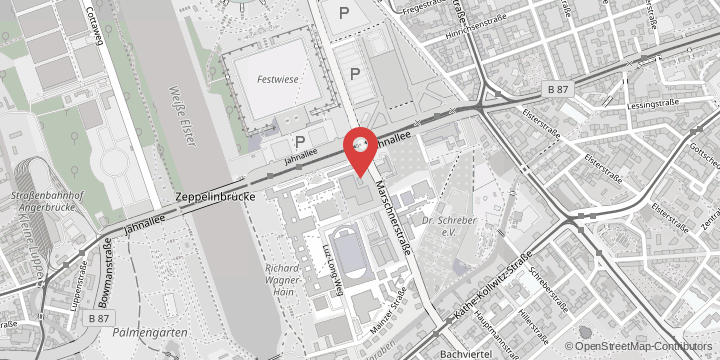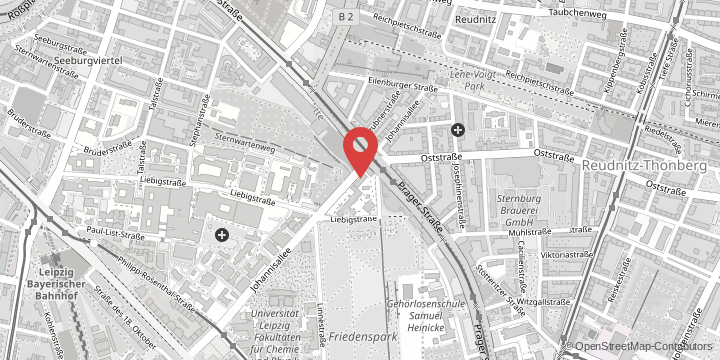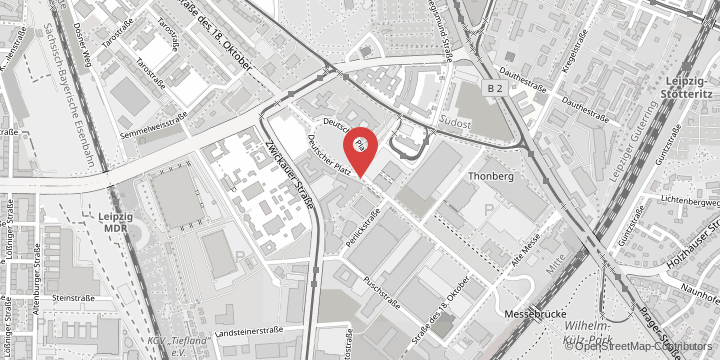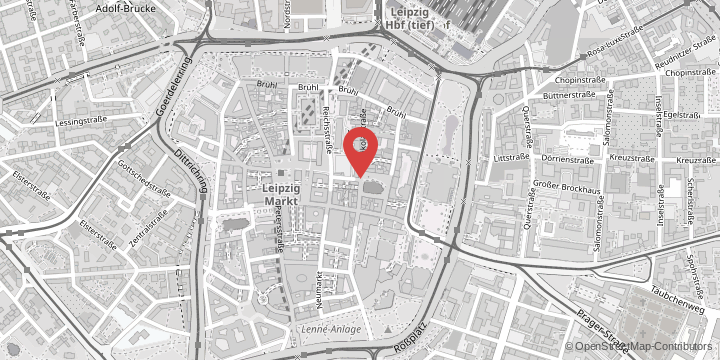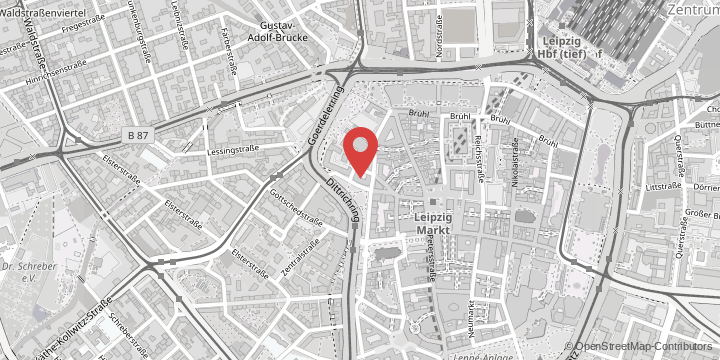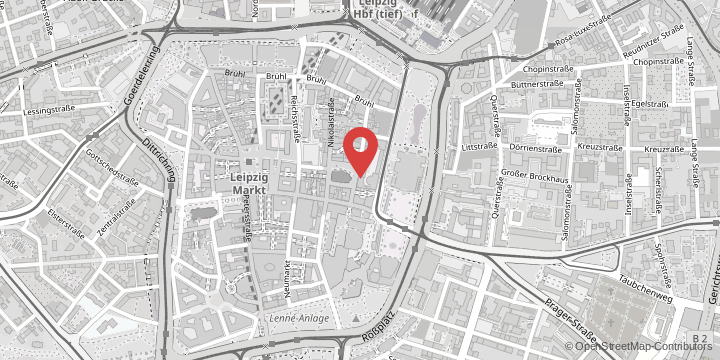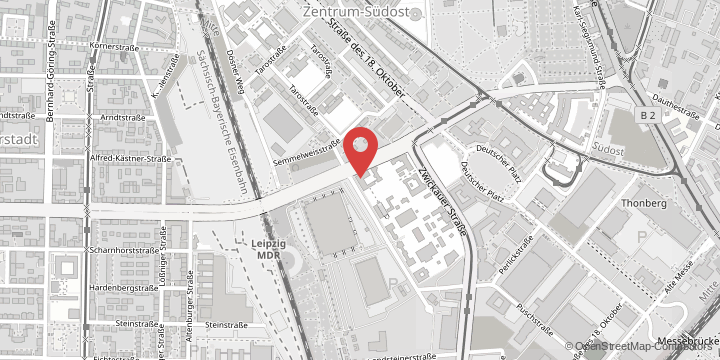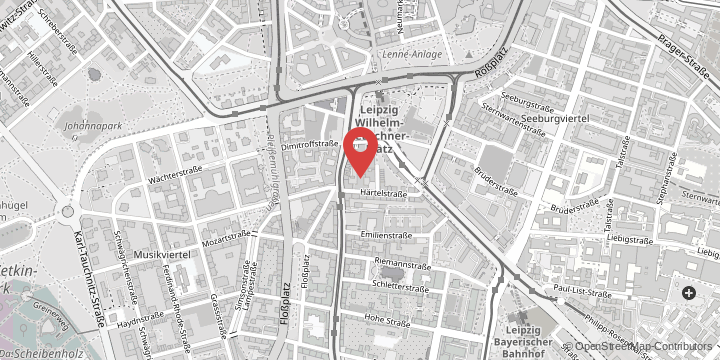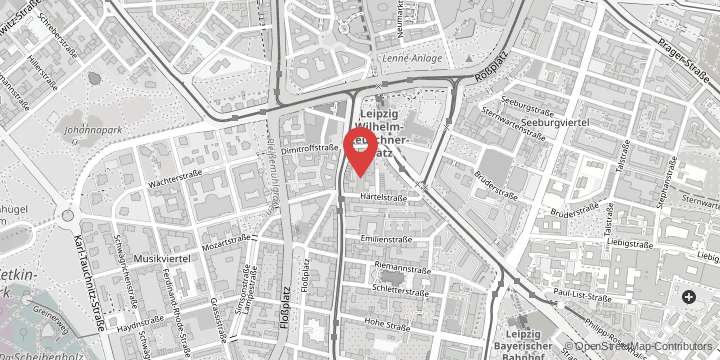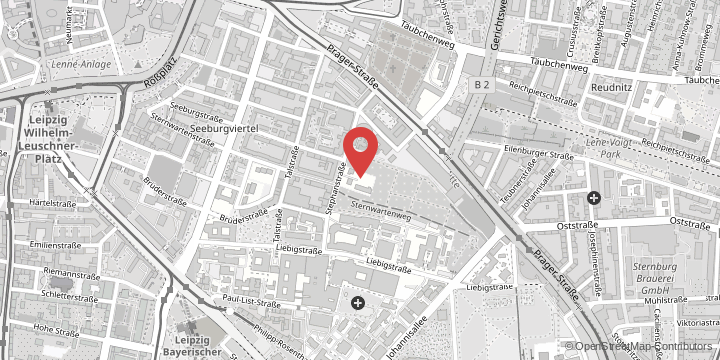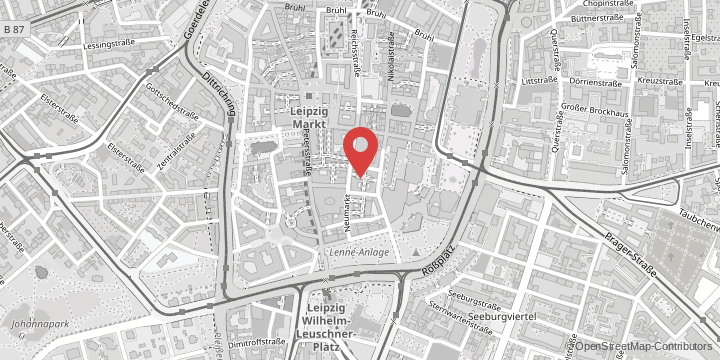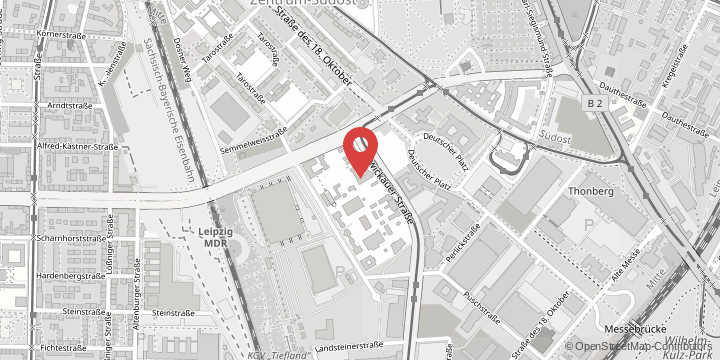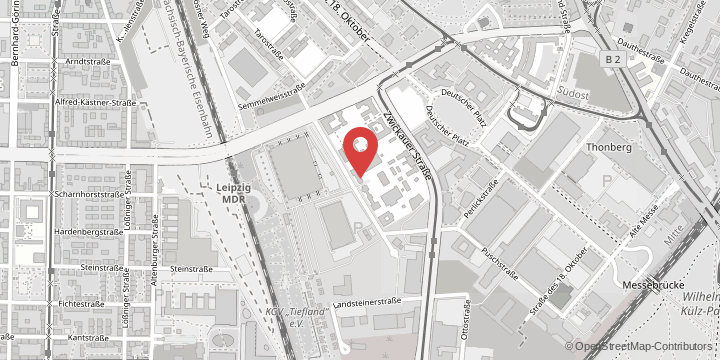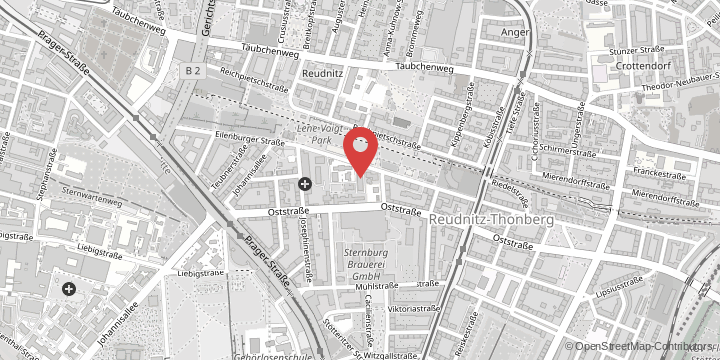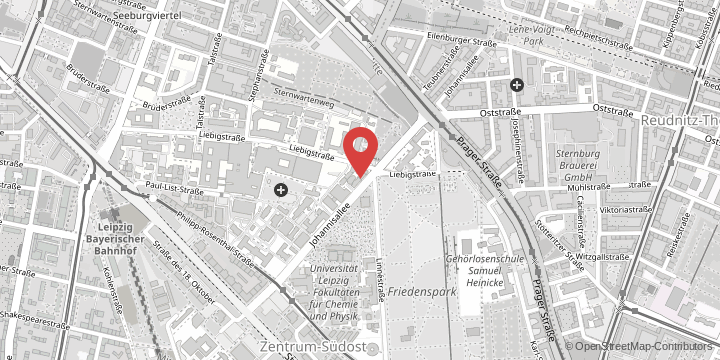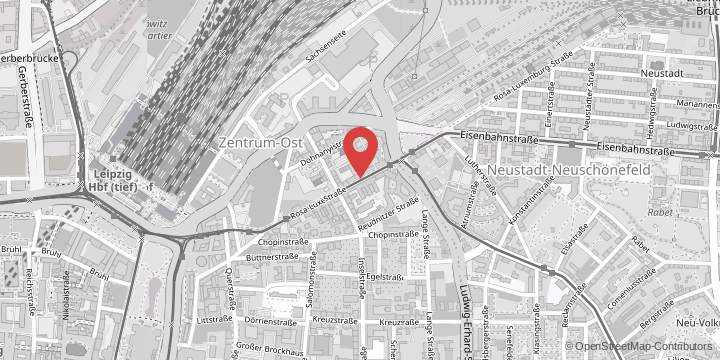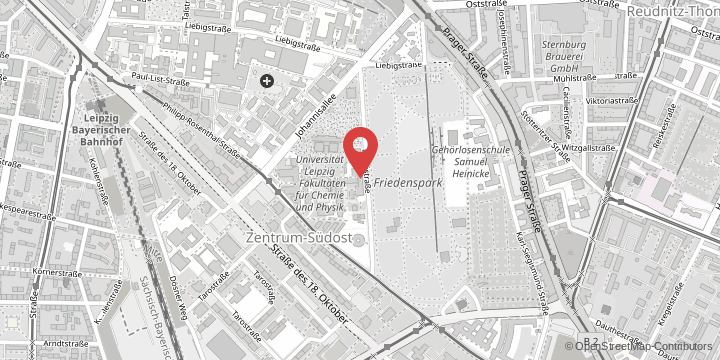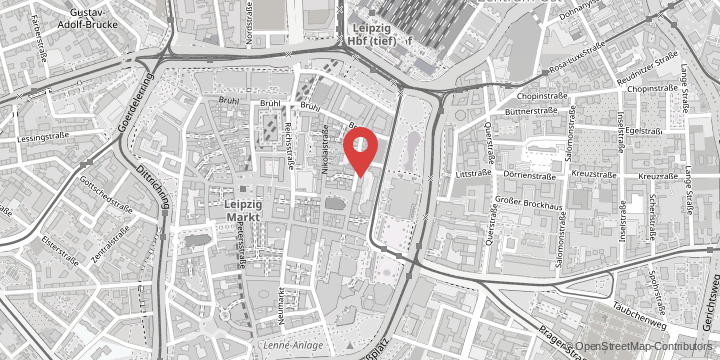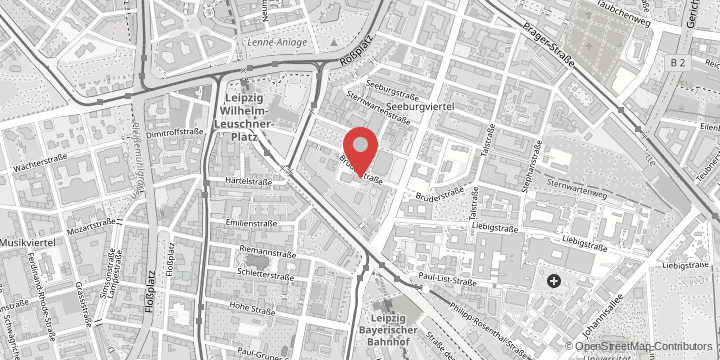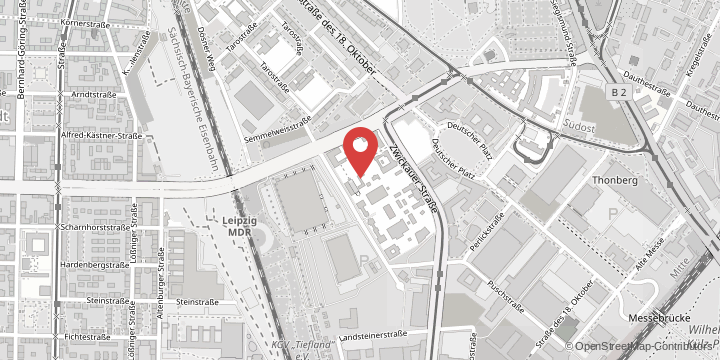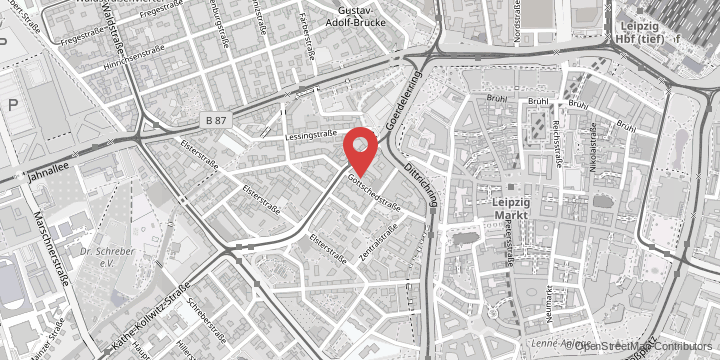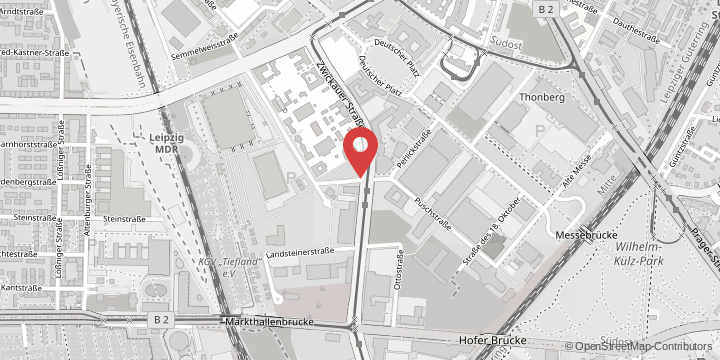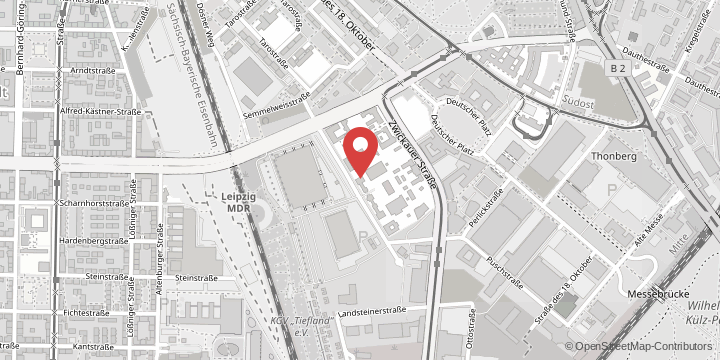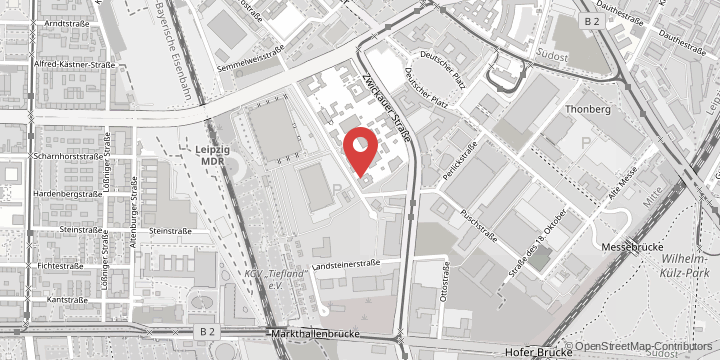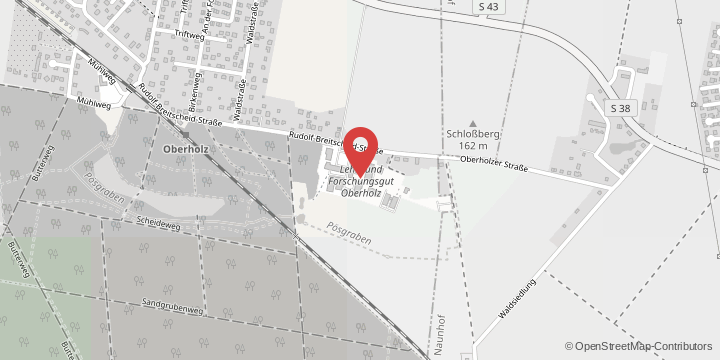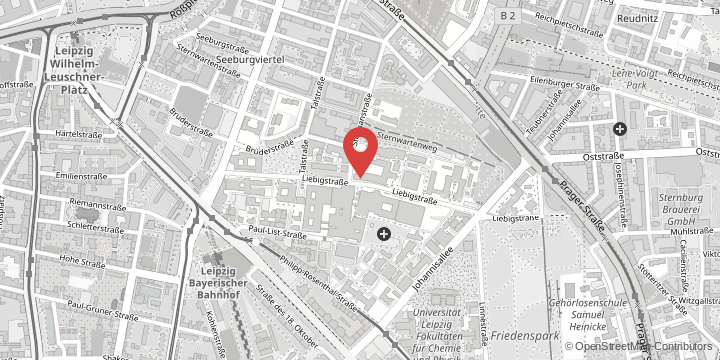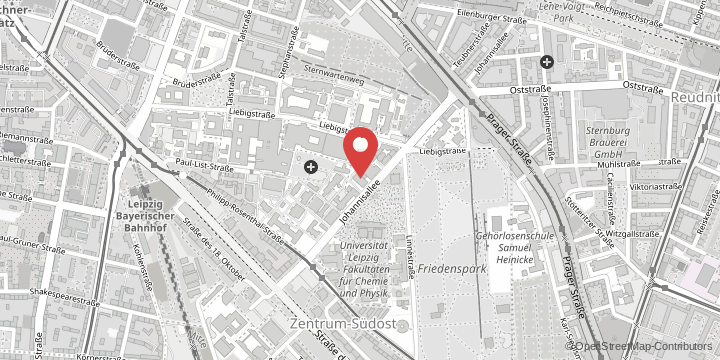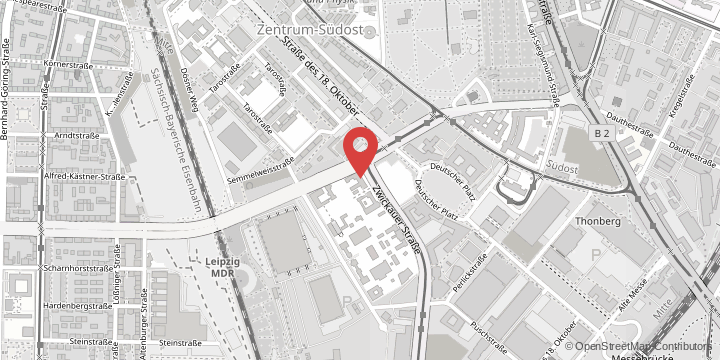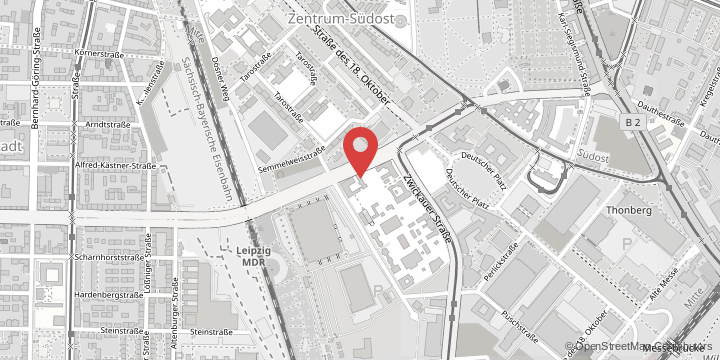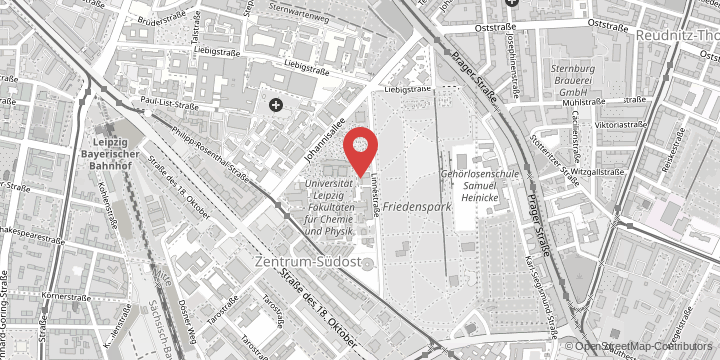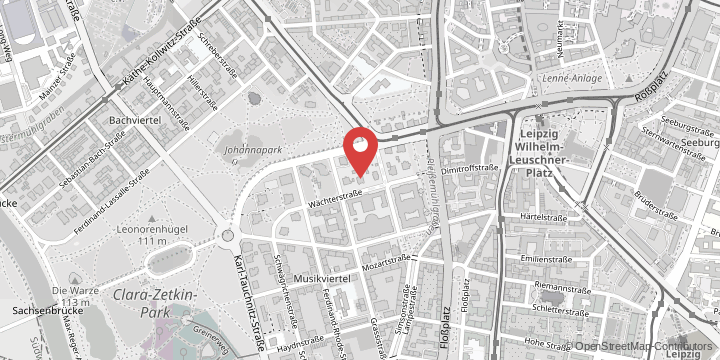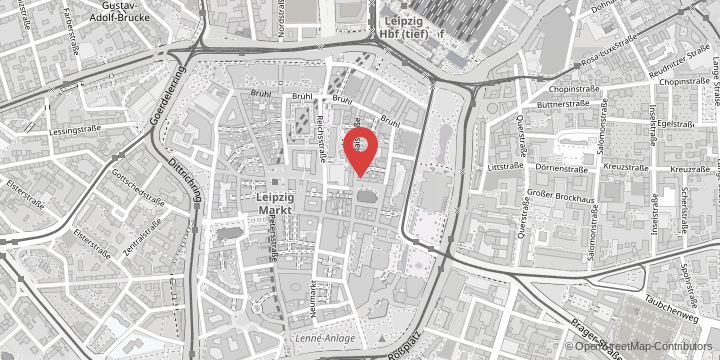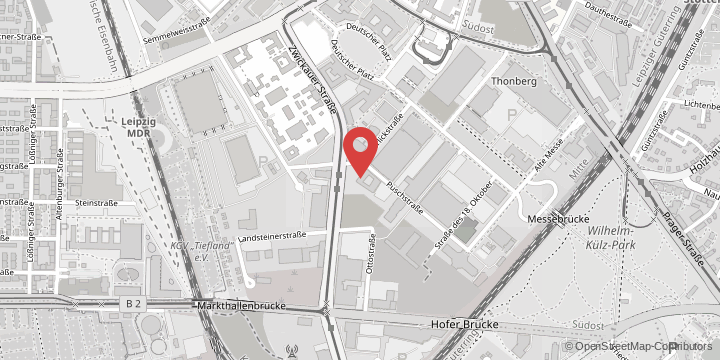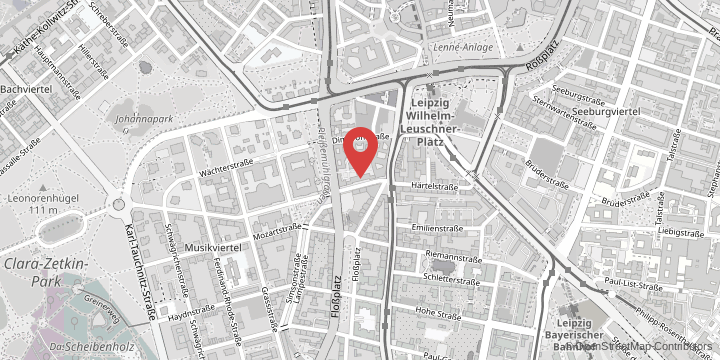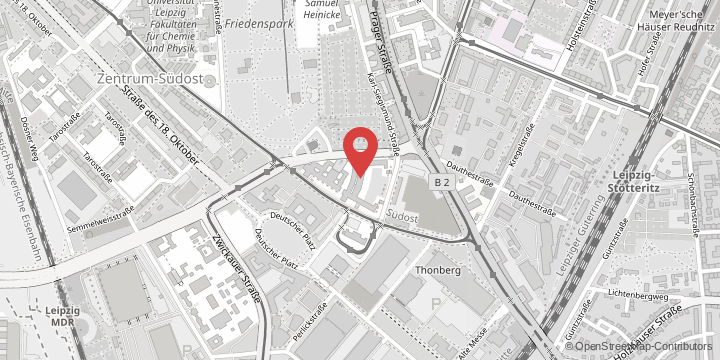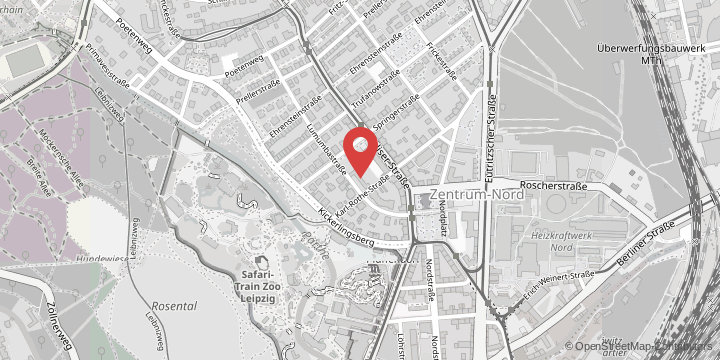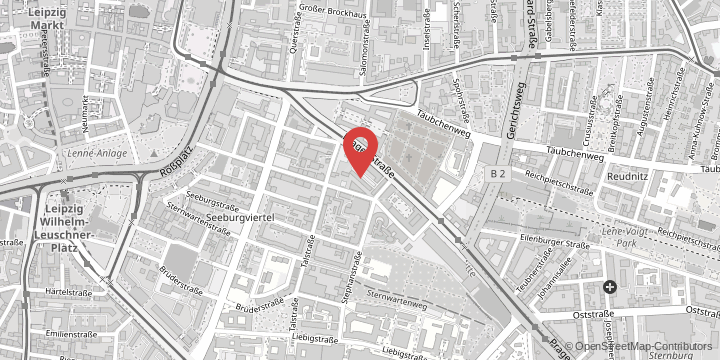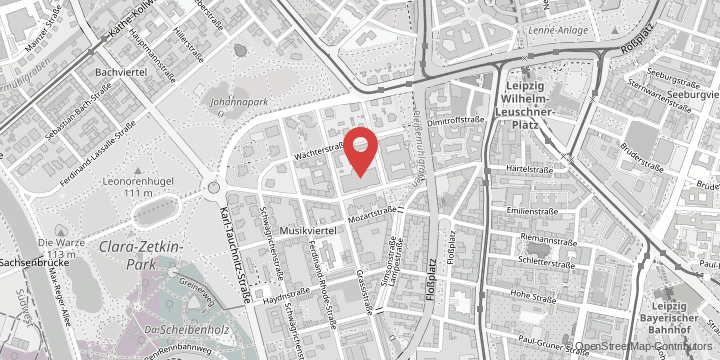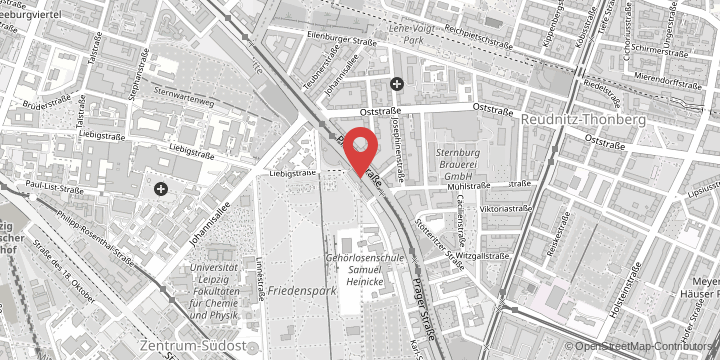Leipziger Universitätsmagazin: Herr Professor Bertsche, gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der Verschreibung und Anwendung von Medikamenten?
Prof. Dr. Thilo Bertsche: In der Verschreibungshäufigkeit von Arzneimitteln gibt es in der Tat dokumentierte Unterschiede. Auch Selbstmedikation nehmen Frauen öfter als Männer in Anspruch. Sie nehmen beispielsweise bei denen vom Arzt verordneten Medikamenten deutlich häufiger Mittel gegen Migräne, Schilddrüsenmedikamente oder Psychopharmaka ein. Bei Männern liegen die Raten etwa bei Cholesterinsenkern und Mitteln gegen Blutgerinnsel höher. Das kann durch eine größere Häufigkeit einer bestimmten Erkrankung bei Frauen begründet sein. Es kann jedoch auch daran liegen, dass manche Erkrankungen bei Frauen oder Männern eher, auch vom Arzt, beachtet werden. Es kann sich sogar darin manifestieren, dass Krankheiten bei einem Geschlecht eher sozial akzeptiert sind. Beispielsweise ist bekannt, dass Depressionen oder Osteoporose bei Männern in höherem Maße missachtet oder von Patienten selbst vernachlässigt werden.
Gibt es Unterschiede für den Nutzen einzelner Arzneimittel bei Frauen und Männern?
Es gibt bei einzelnen Arzneistoffgruppen durchaus Hinweise, dass diese ein unterschiedliches Wirkungs- und Risikoprofil zeigen. Beispielsweise soll die Reduktion der Sterblichkeit dank ACE-Hemmern nur bei Männern signifikant sein. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass die Behandlungsgruppe der Frauen in entsprechenden Studien, statistisch gesehen, möglicherweise zu klein war, um gleichwertige Effekte nachweisen zu können. Das zeigt wiederum, wie sehr bei der Interpretation solcher Daten Vorsicht geboten ist. Das gilt vor allen Dingen, wenn im Alltag nicht mehr die in Studien gut standardisierten Bedingungen vorherrschen. Hier kann sich beispielsweise eine geringere Einnahmetreue bei Männern auch ungünstig auswirken und dazu führen, dass potenziell mögliche Effekte aus klinischen Studien unter Routinebedingungen gar nicht erreicht werden oder von vermeidbaren unerwünschten Risiken überschattet werden.
Wie häufig kommt es vor, dass Arzneimittel bei Frauen nicht wirken oder unerwünschte Wirkungen überwiegen?
Durch die neueren, auf Genderaspekte besser ausgerichteten, regulatorischen Änderungen bei der Arzneimittelzulassung und der Nutzenbewertung sind bislang kaum wirklich klinisch relevante Unterschiede gezeigt wurden. Das heißt, dass wir davon ausgehen können, dass unter Genderaspekten unsere Therapien generell nicht für Frauen völlig unwirksam oder hochgefährlich sind. Die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt wird ohnehin durch eine Therapieüberwachung immer den individuellen Erfolg bei vertretbaren Risiken im Blick haben. Daher sollten wir aus dieser Thematik keine unbegründeten Sorgen bei der ärztlich begleiteten Arzneimitteltherapie oder der zeitlich befristeten Selbstmedikation ableiten. Allerdings können wir aus den vorliegenden Erkenntnissen auch nicht schließen, dass es nicht durchaus für Frauen noch besser geeignete oder besser verträgliche Arzneimittel geben könnte.
Woran liegt es, dass heute noch keine ausreichenden Erkenntnisse vorliegen?
Das hat bereits mit der präklinischen Entwicklung von Arzneistoffen und Arzneimitteln zu tun. Um möglichst gut vergleichbare Versuchsbedingungen zu halten, werden die pharmakologischen Wirkungen gerne an möglichst homogenen Gruppen, beispielsweise an jungen männlichen Mäusen, untersucht. Zyklusabhängigkeiten kann man auf diese Weise auch ausschließen. Sofern aber geschlechtsabhängige Unterschiede bestehen, führt dies dazu, dass genau genommen nur die Wirkung bei männlichen Tieren auch tatsächlich nachgewiesen wurde. Fast noch schlimmer: Die sich hier als wirksam erwiesenen Substanzen werden entsprechend weiterentwickelt und andere, vielleicht bei weiblichen Tieren besser wirksame oder risikoärmere, gar nicht identifiziert. Das heißt, dass hier noch Entwicklungspotenzial ist.
Wäre es sinnvoll, Frauen verstärkt in klinische Studien einzuschließen, um das genauer zu untersuchen?
Selbstverständlich. Das wird durch die bisherigen Änderungen im Arzneimittelgesetz und Anforderungen in der Nutzenbewertung durch den gemeinsamen Bundesausschuss auch bereits angestrebt. Allerdings sollte man bedenken, dass Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit grundsätzlich für Frauen ein höheres Risikopotenzial in Studien mit sich bringen und solche Risiken auch möglichst geringgehalten werden sollten. Dies ist auch umgekehrt der Grund, warum in der Schwangerschaft gerade besonders gut untersuchte und etablierte Arzneistoffe zum Einsatz kommen. Es ist auch ein Beispiel dafür, dass neue Arzneimittel – selbst wenn diese schon Daten an Frauen aufweisen – aufgrund des geringeren Erfahrungsschatzes und der insgesamt schlechteren Langzeitstudienlage nicht zwangsläufig besser geeignet sein müssen als ältere Arzneimittel.
Ist es für die sich anschließenden klinischen Studien am Menschen ein Problem, wenn bislang präklinische Daten eher wenig Erkenntnisse für die Anwendung bei Frauen liefern?
Ja. Ein besonders interessanter Aspekt resultiert beispielweise daraus, wenn in präklinischen Entwicklungen vorzugsweise männliche Tiere eingesetzt wurden. Wenn nun in klinischen Studien zuvor eigentlich nur an männlichen Individuen optimierte Behandlungen eingesetzt werden, könnten sich diese an gemischten Populationen in der klinischen Phase am Menschen zum einen als nicht optimal wirksam erweisen, zum anderen bei weiblichen Probanden eher unerwünschte Wirkungen auftreten. Für solche Phänomene gibt es tatsächlich Hinweise, gerade von Arzneimitteln zur Behandlung von Herzerkrankungen. Das heißt aber auch, dass Genderaspekte eigentlich bereits in der frühen Arzneimittelentwicklung bedacht werden sollten.
Vielen Dank für das Gespräch.