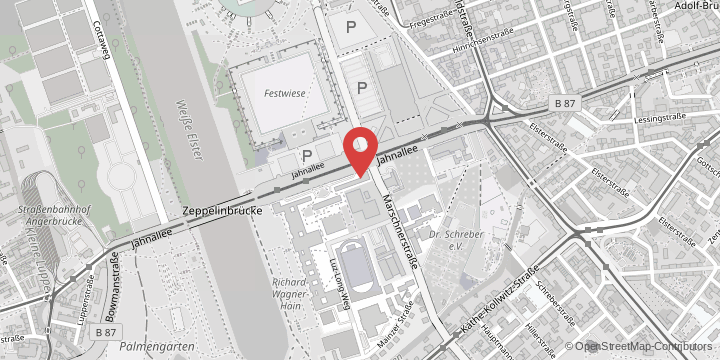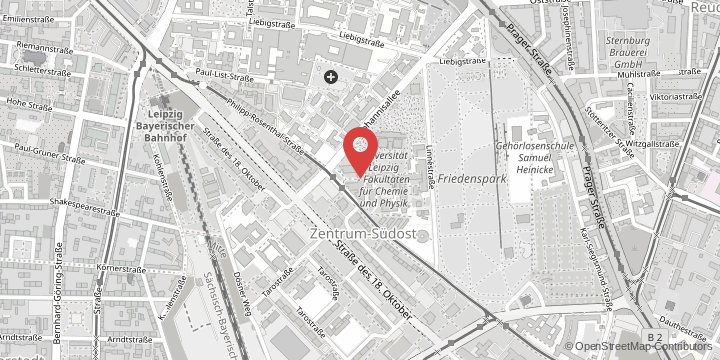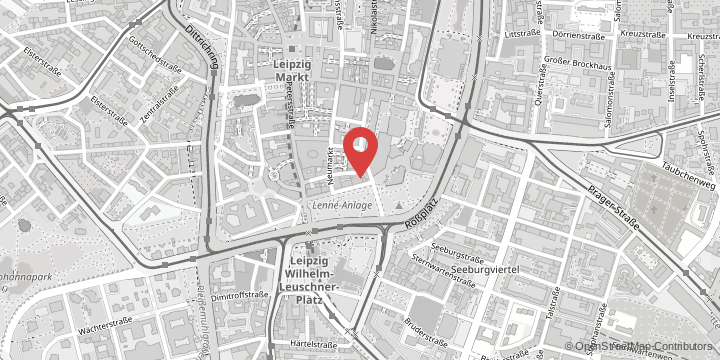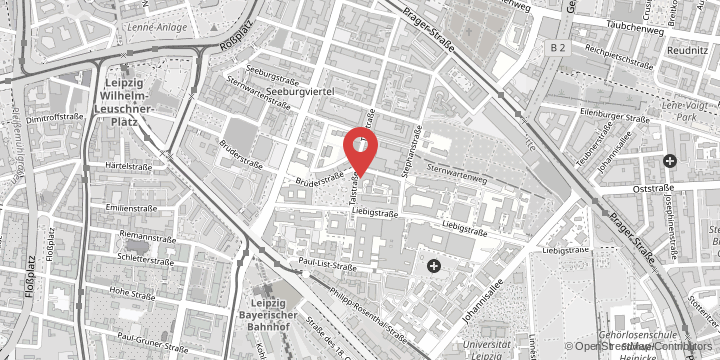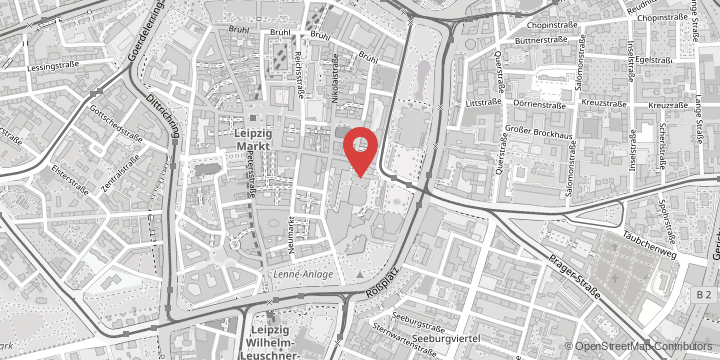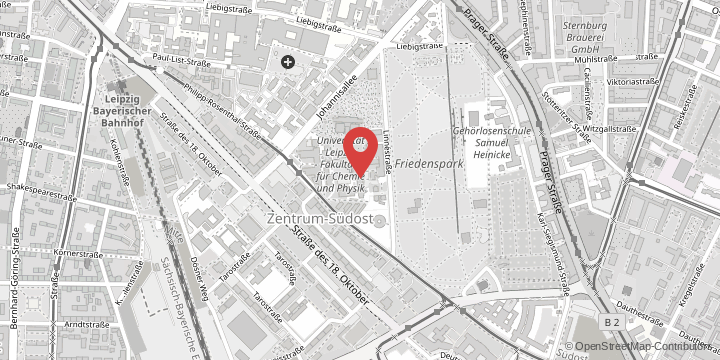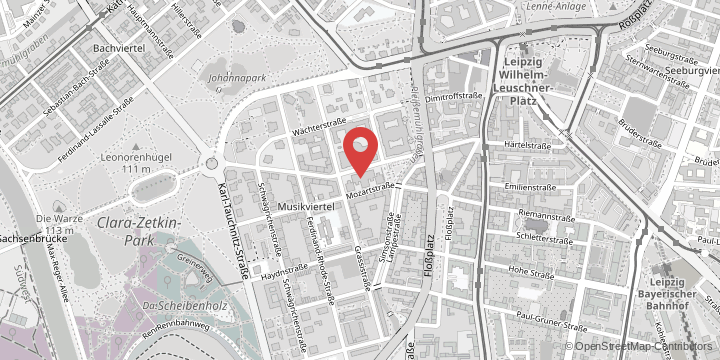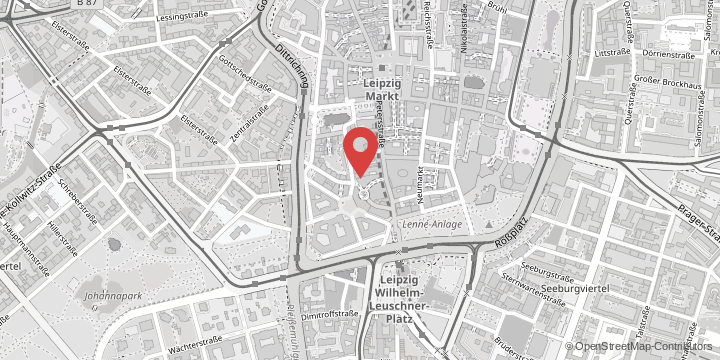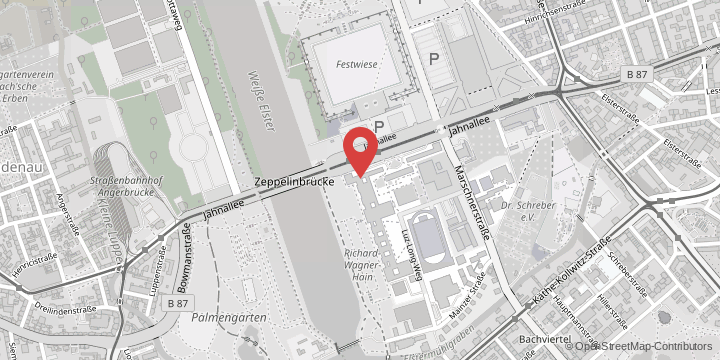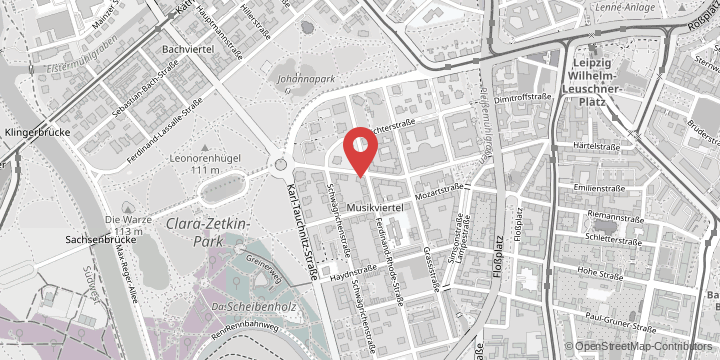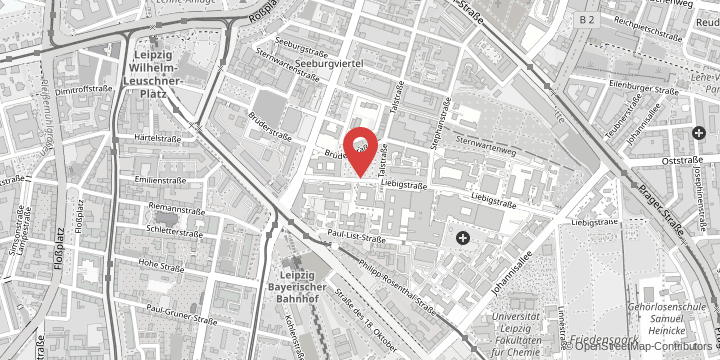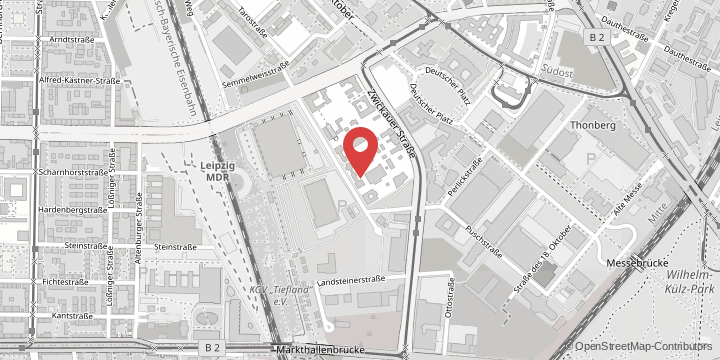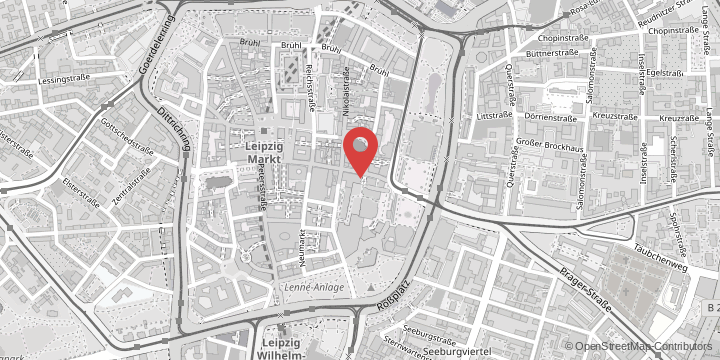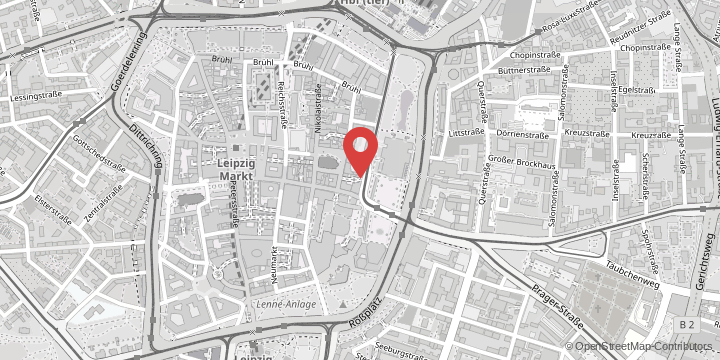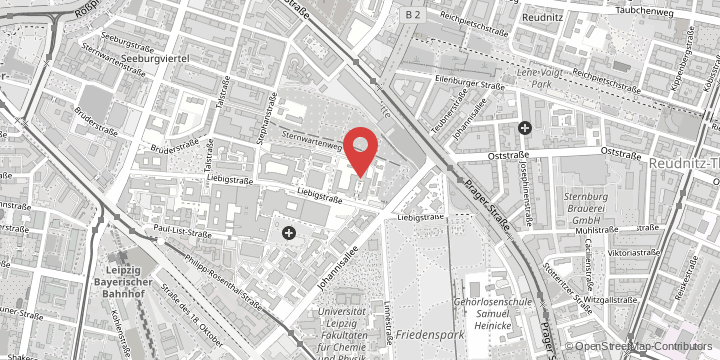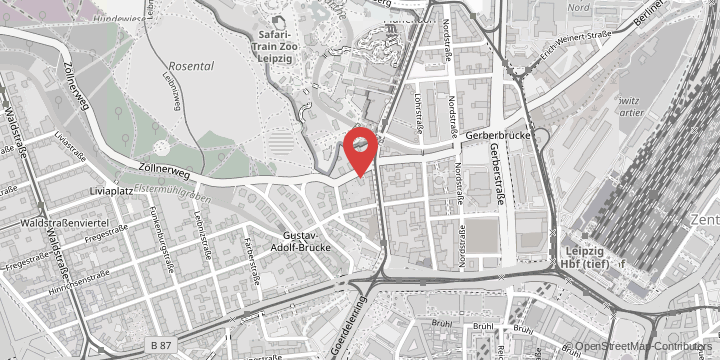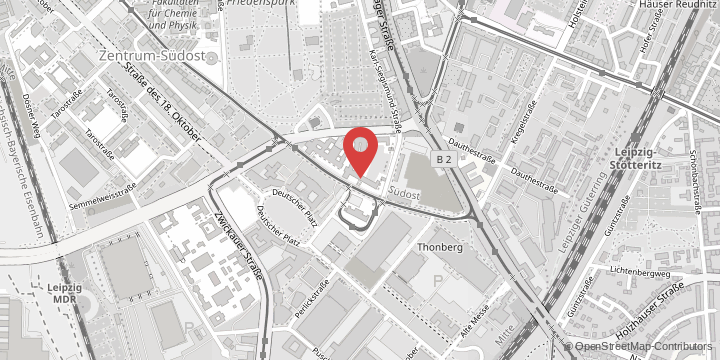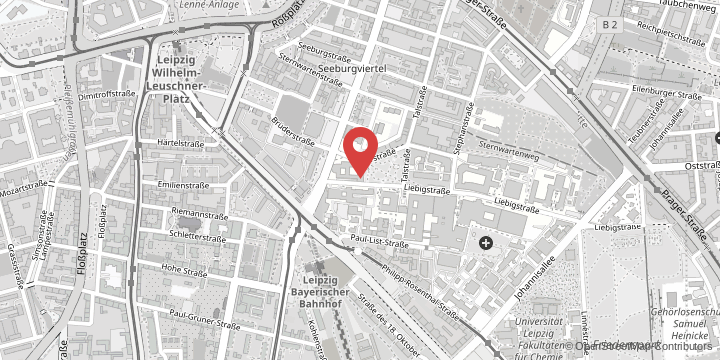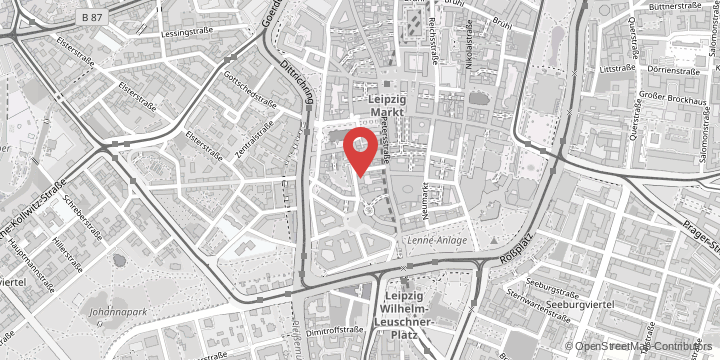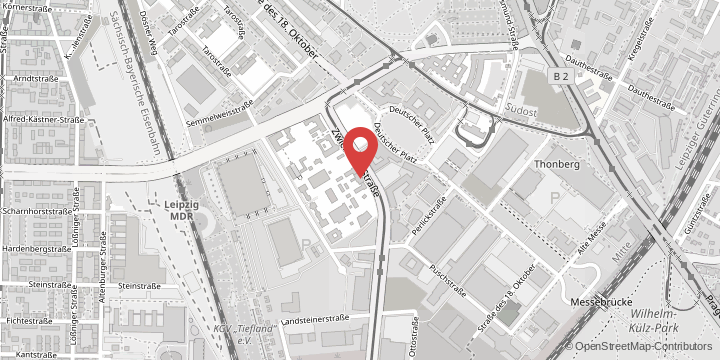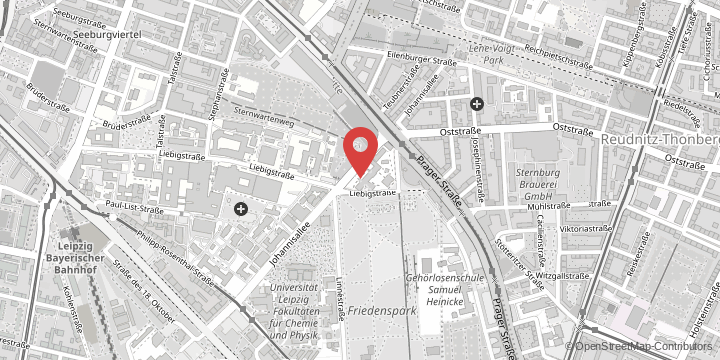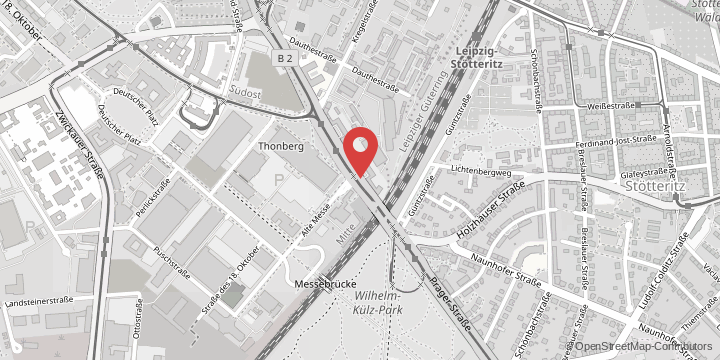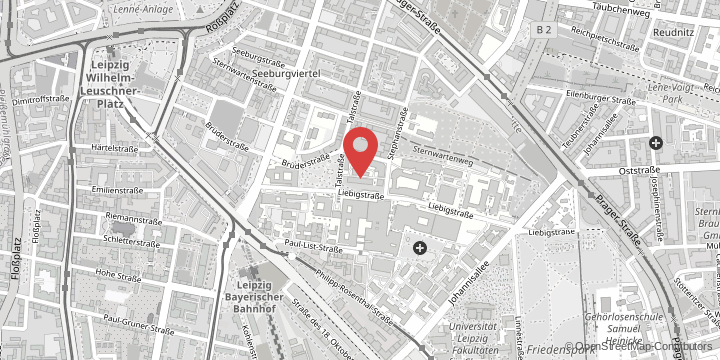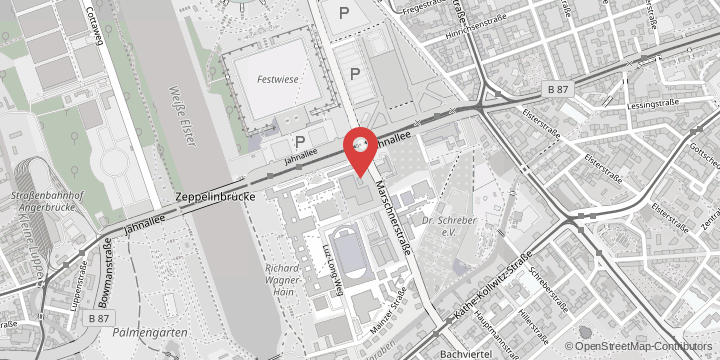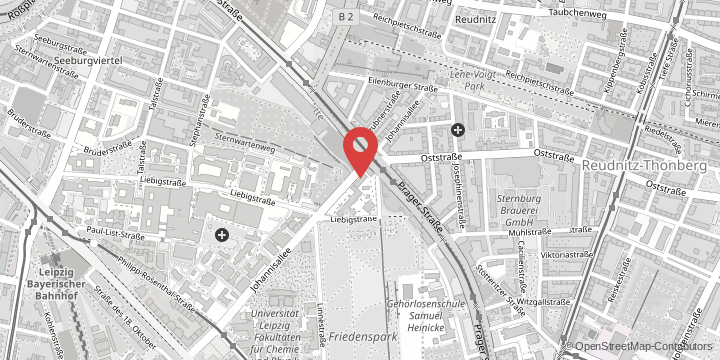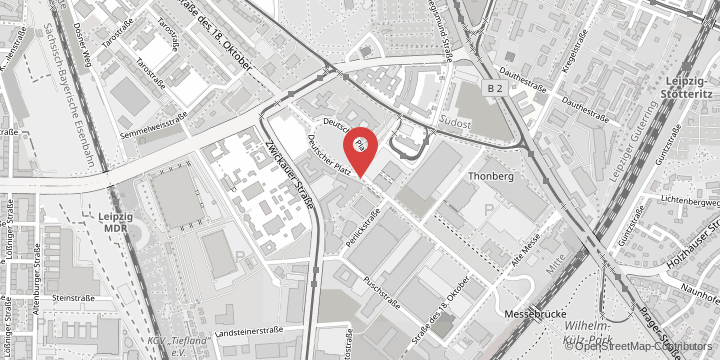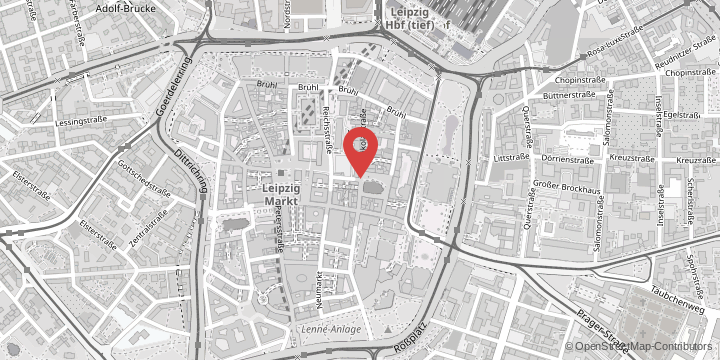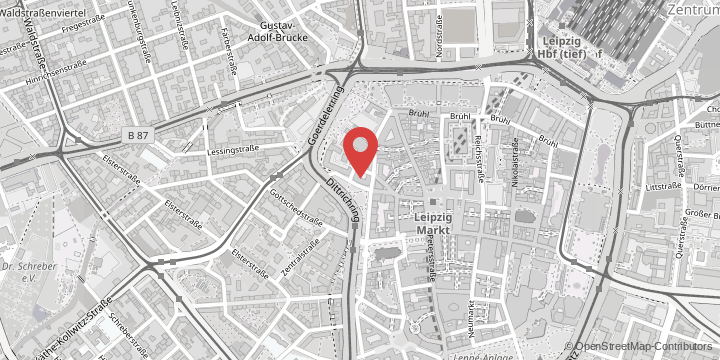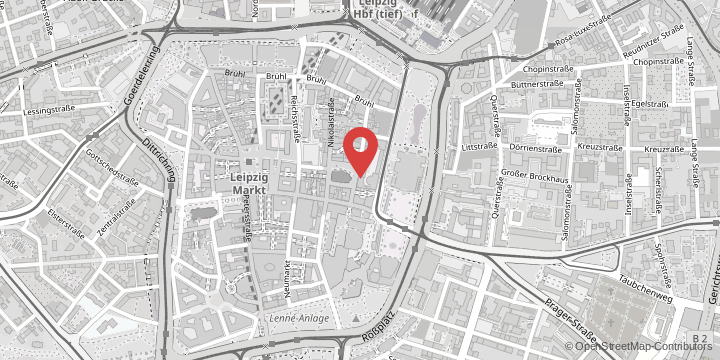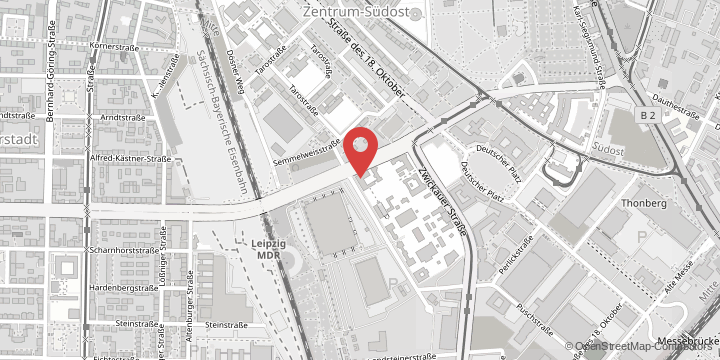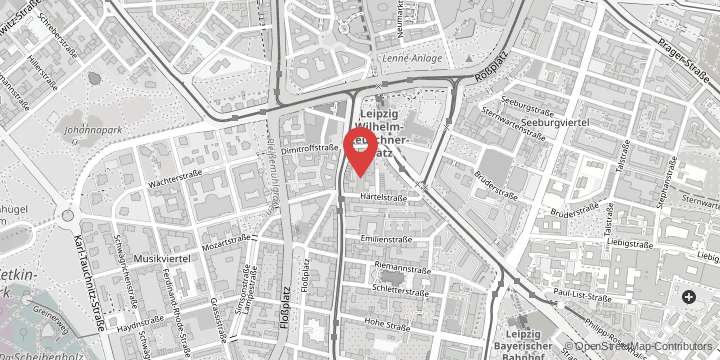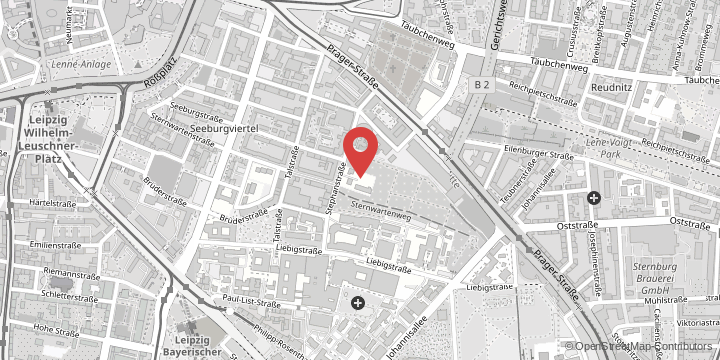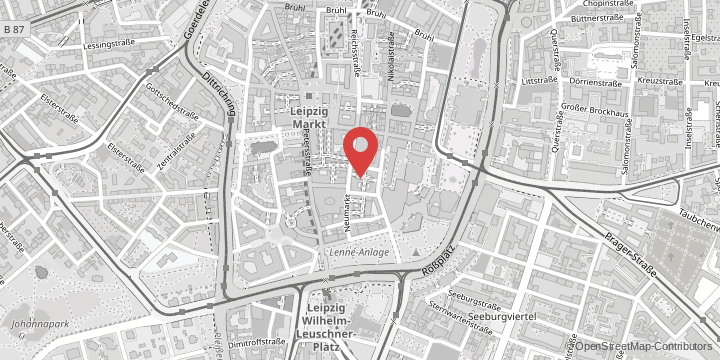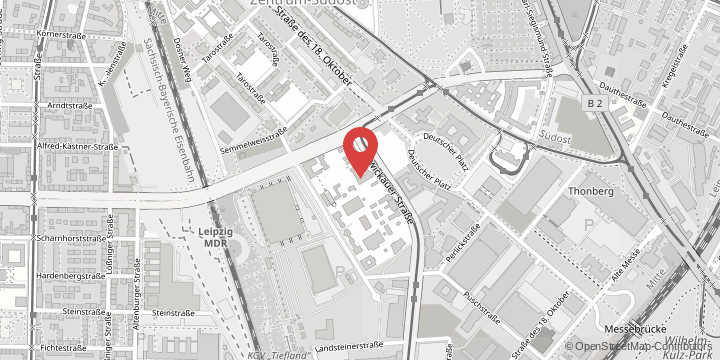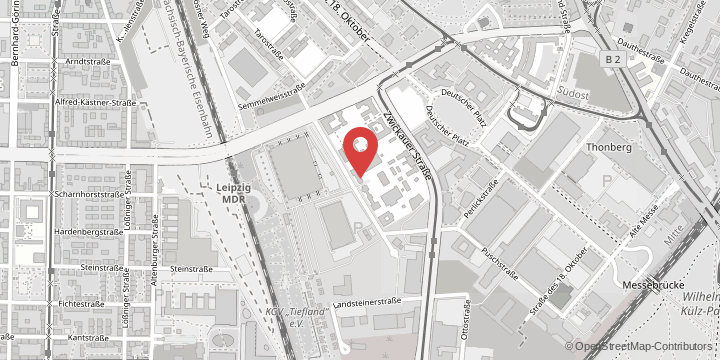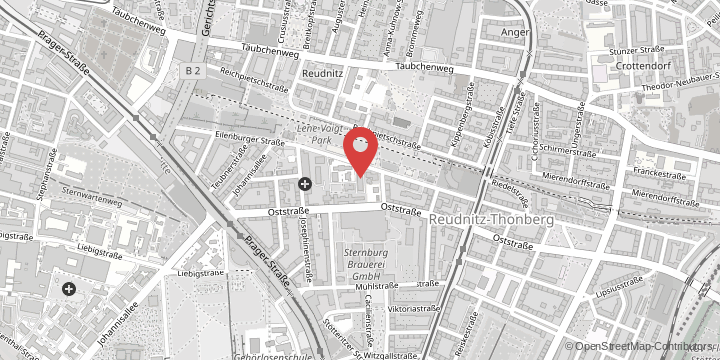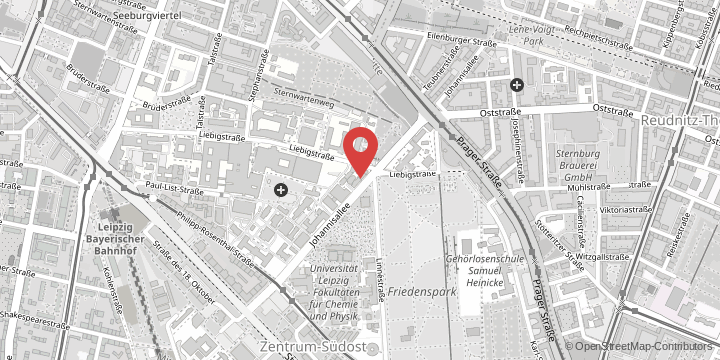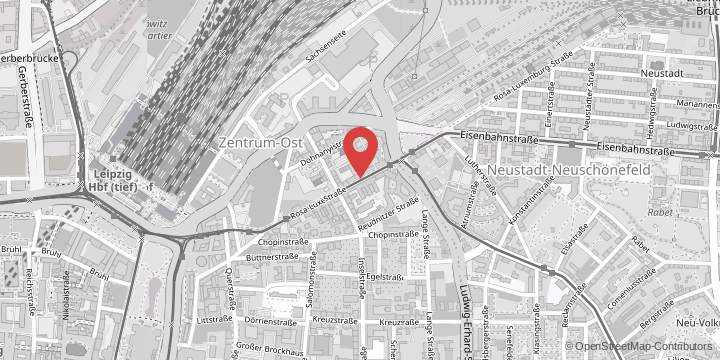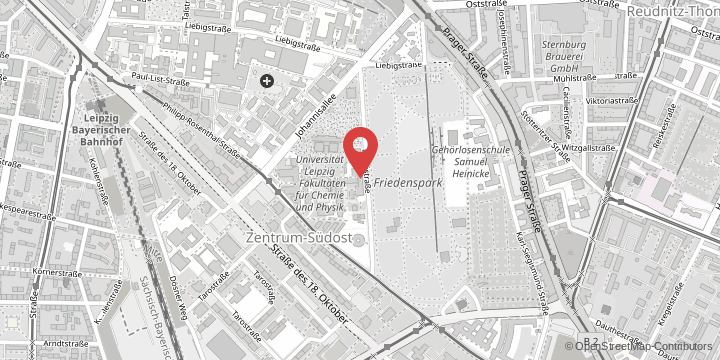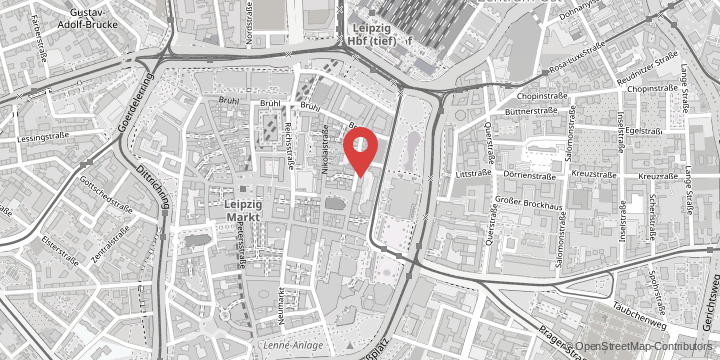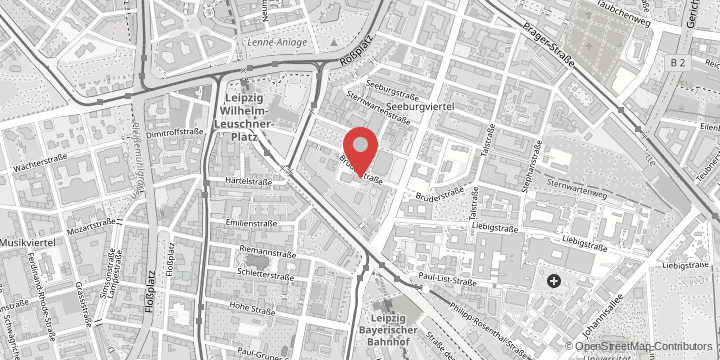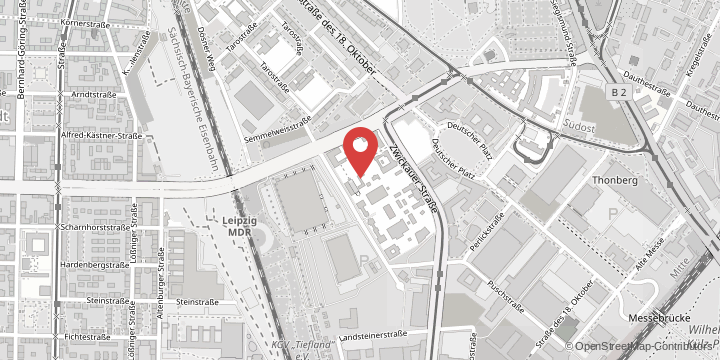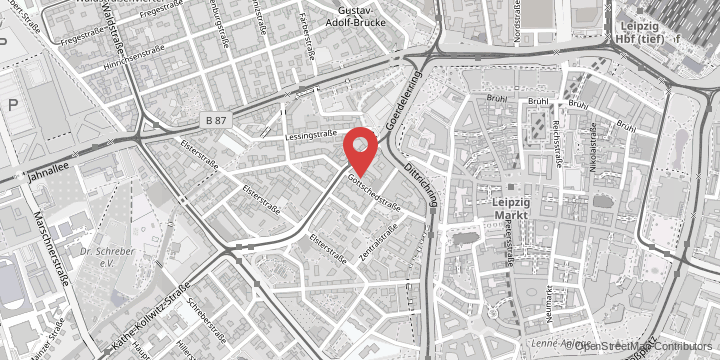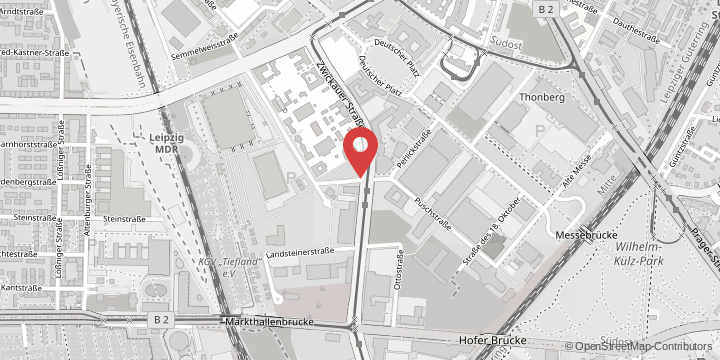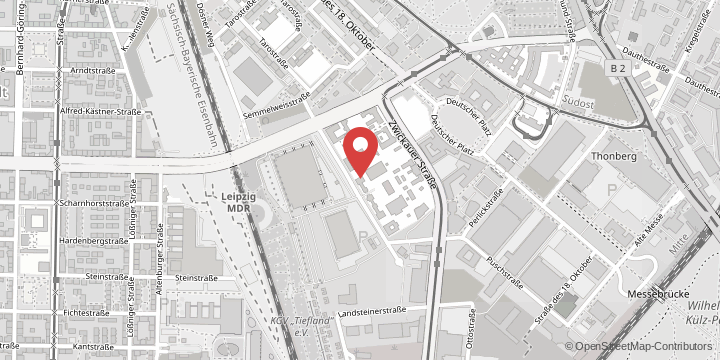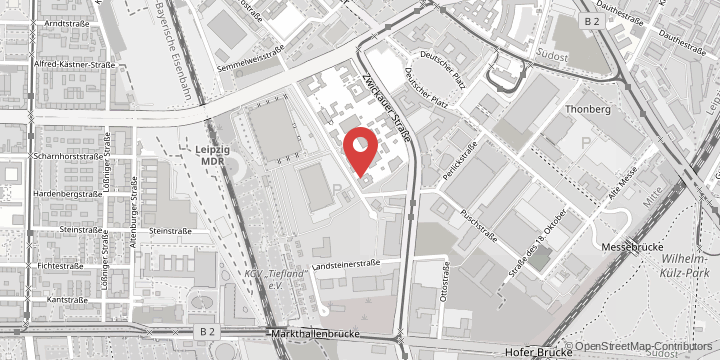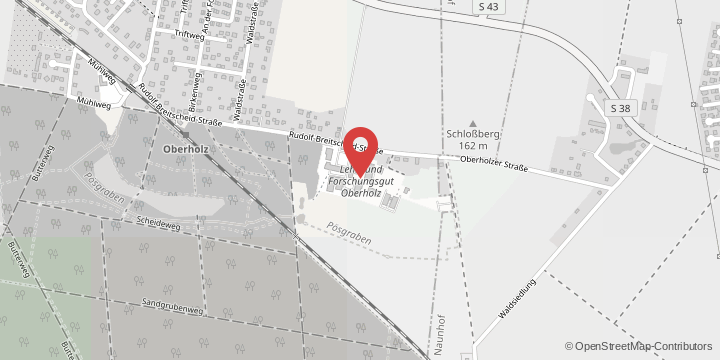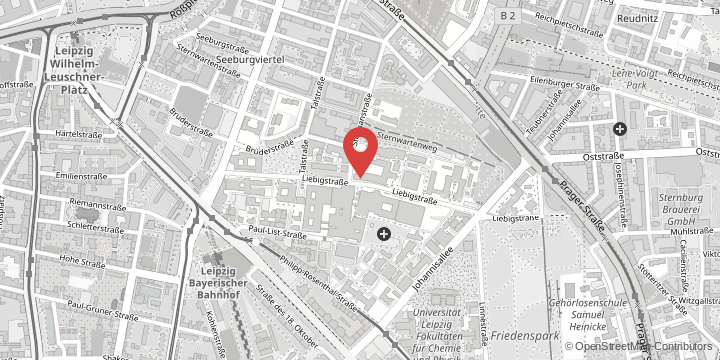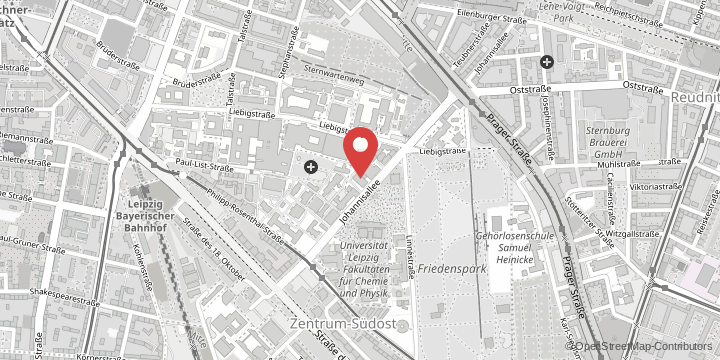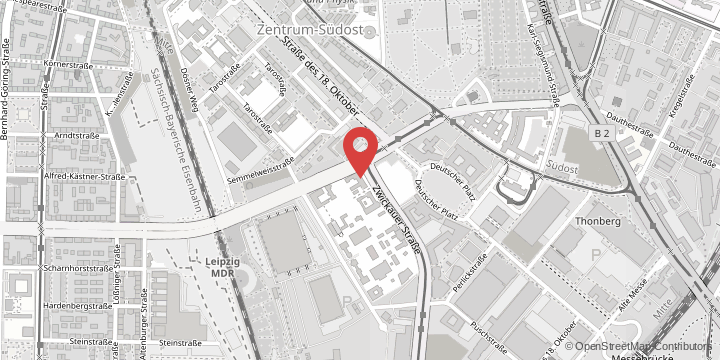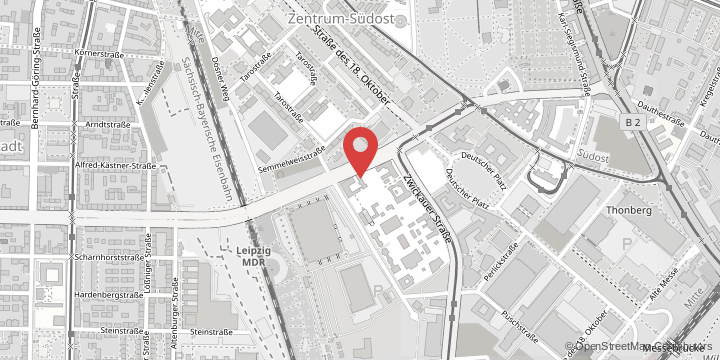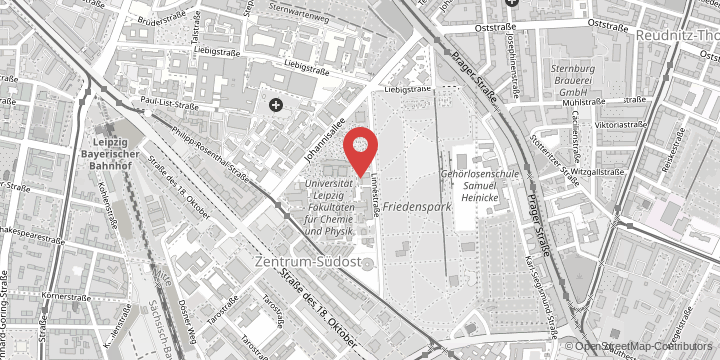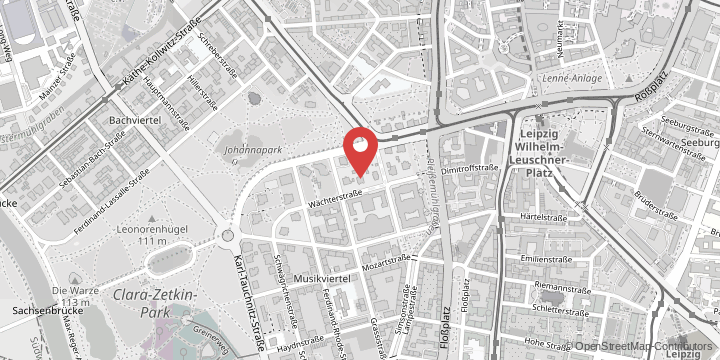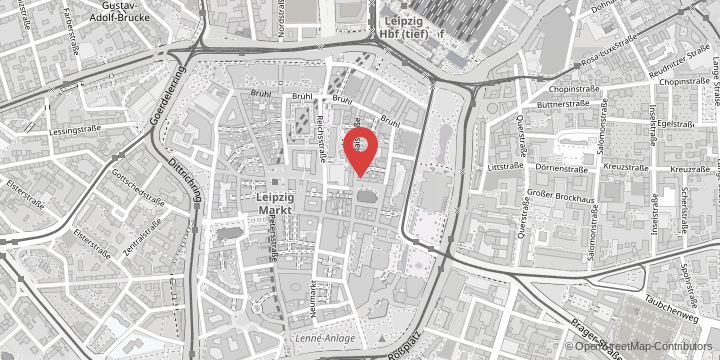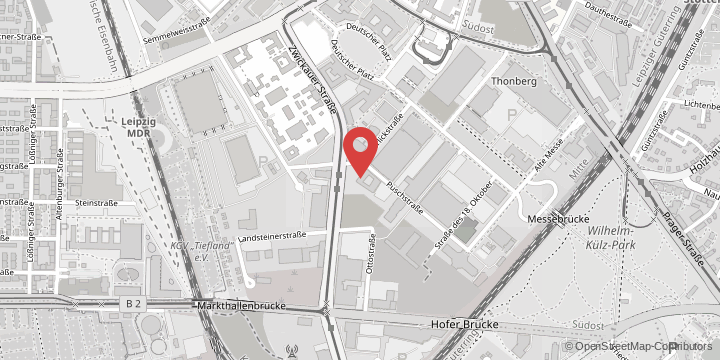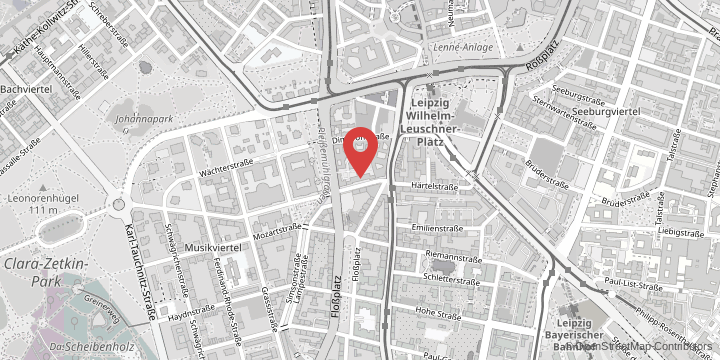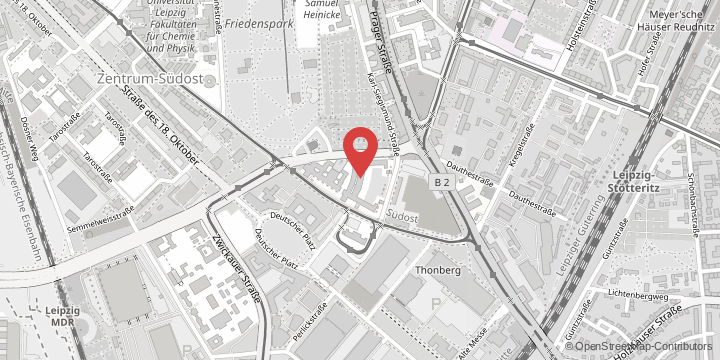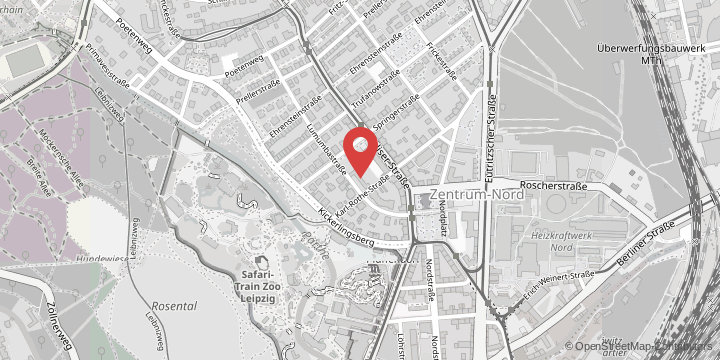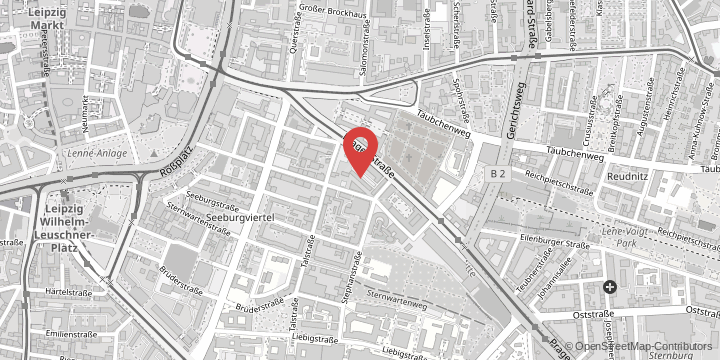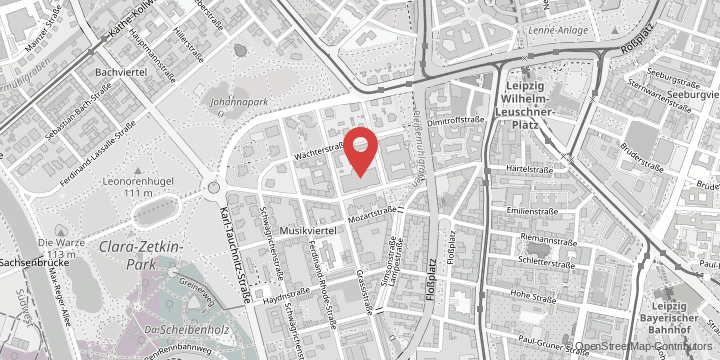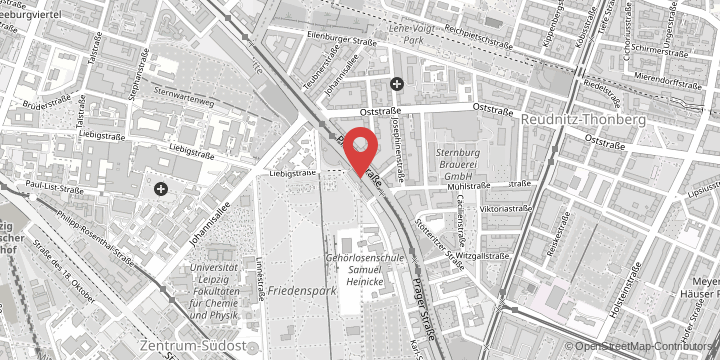Prof. Schomerus, welche Suchterkrankungen sind in Deutschland am stärksten verbreitet und sollten in den Medien besonders sensibel behandelt werden?
Suchtmittel sind bei uns alltäglich. Insbesondere Alkohol wird in Deutschland in großen Mengen konsumiert, jeder Mensch über 15 Jahre nimmt im Durchschnitt über zehn Liter reinen Alkohol im Jahr zu sich. Dabei sind die Grenzen zur Suchterkrankung fließend, etwa zehn Prozent der Männer und sieben Prozent der Frauen entwickeln im Laufe ihres Lebens eine Abhängigkeit. Die negativen Gesundheitsfolgen fangen aber viel früher an. Neben dem Risiko für Unfälle unter Alkoholeinfluss ist Alkohol eine wichtige Ursache sehr vieler Krankheiten: Nicht nur die sprichwörtliche Leberschädigung, sondern auch Schlaganfälle, Herzinfarkte, Krebserkrankungen. Es ist dabei häufig so, dass man mit dem Finger auf Menschen mit einer Suchterkrankung zeigt, aber den eigenen problematischen Konsum tabuisiert. Das liegt an der enormen Stigmatisierung von Suchterkrankungen. Niemand möchte zu dieser Gruppe gehören, über die es so viele negative Vorurteile gibt. Und da liegt es nahe, das eigene Konsumverhalten auch vor sich selbst schön zu reden.
Das Bild, das die Öffentlichkeit von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen wie Alkoholsucht zeichnet, ist auch von Darstellungen in den Medien geprägt. Wie können Journalist:innen in ihrer Berichterstattung am besten helfen, Vorurteile gegenüber Suchtkrankheiten zu vermeiden?
Ein sensibler Umgang mit Wortwahl und Bildsprache ist wichtig. Es muss zunächst einmal der Respekt vor den Menschen gewahrt bleiben, die dargestellt werden. Das ist eigentlich absolut selbstverständlich, aber die Berichterstattung über Suchtkrankheiten sieht leider oft ganz anders aus und das ist nicht akzeptabel. Eine Medienanalyse unserer Projektpartner in Hannover hat gezeigt: Eine Berichterstattung, die Suchterkrankungen vor allem im Kontext von Kriminalität, Kontrollverlust und persönlicher Schwäche darstellt, zeichnet ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit und liefert einen Nährboden für Stigmatisierung. Wir lesen viel zu wenig über Recovery, über Wege aus der Sucht, über Menschen, die mit großen Schwierigkeiten fertig geworden sind. Menschen, die eine Suchterkrankung überwunden haben, sind Helden. Sie sind Vorbilder – aber sie sind kaum zu sehen, weil es so schwierig ist, über diese Erfahrungen zu sprechen, wenn man befürchten muss, dafür abgestempelt und ausgegrenzt zu werden. Eine Berichterstattung, die Behandlung und Hilfe beschreibt, die zeigt, dass Suchtkrankheiten gut behandelbar sind und dass es viele Menschen gibt, die das geschafft haben – so eine Berichterstattung kann Menschen ermutigen, selbst Hilfe zu suchen.
Wie kann Menschen mit Suchterkrankungen geholfen werden?
Da gibt es ganz viele verschiedene Wege. Suchtberatungsstellen sind ein wichtige Anlaufstelle, oder die Hausärzt:innen. Eine wichtige Frage ist dabei, was wir überhaupt unter erfolgreicher Behandlung verstehen. Oft ist damit Abstinenz gemeint, und das ist sicher auch das allerbeste Ergebnis. Aber häufig ist auch eine Reduktion des Konsums schon ein ganz wichtiger Schritt zu mehr Lebensqualität und weniger Gesundheitsrisiken, gerade bei Menschen mit hohem Alkoholkonsum. Je weniger, desto besser, und jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein Erfolg.
Vor allem die sozialen Medien sind ein Minenfeld für bereits erkrankte oder Hilfe suchende Menschen. Ist Ihr an der Medizinischen Fakultät entwickelter Leitfaden auch eine Unterstützung, um in diesem Bereich der Stigmatisierung von Suchtkranken entgegen zu wirken?
Der Leitfaden ist ein Modell dafür, wie man auch in anderen Kontexten über Sucht und Substanzkonsum sprechen kann, ohne Stigmatisierung, auch in den sozialen Medien. Wir müssen über Substanzkonsum sprechen, ohne die Probleme und Risiken zu verdrängen, und ohne auf die Betroffenen herabzuschauen und sie auszugrenzen. Denn Ausgrenzung löst Suchtprobleme nicht, sondern verstärkt sie.