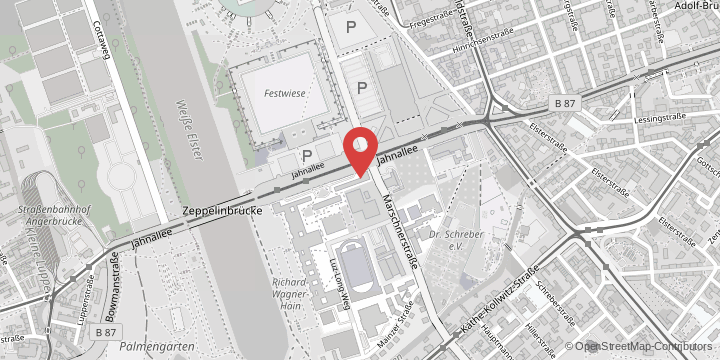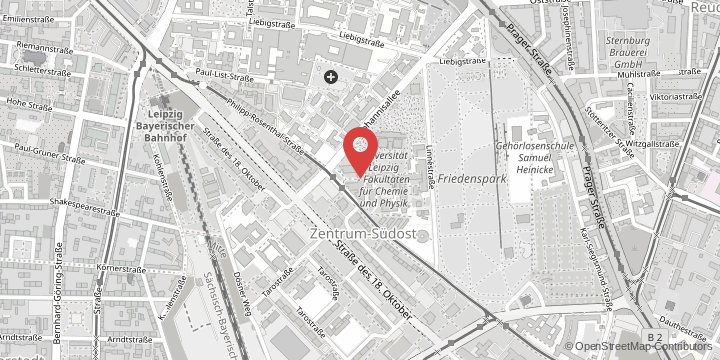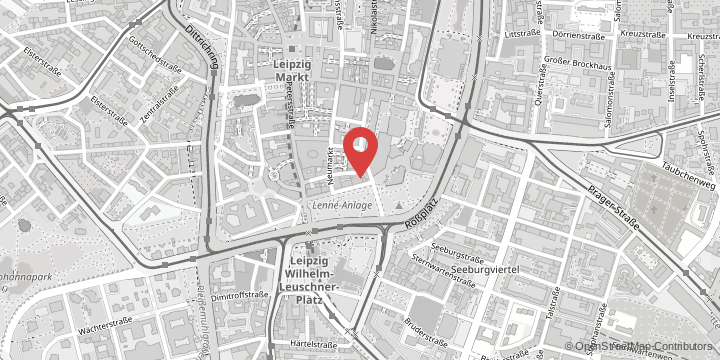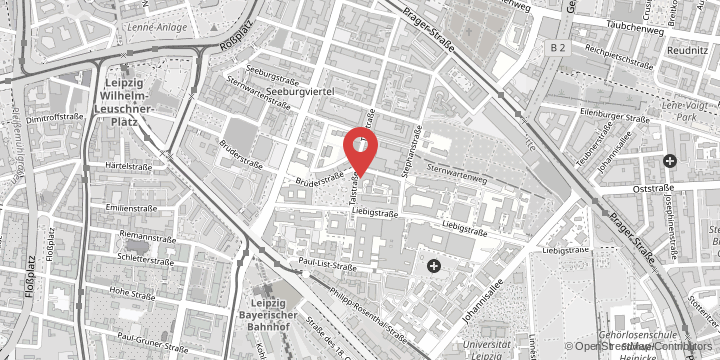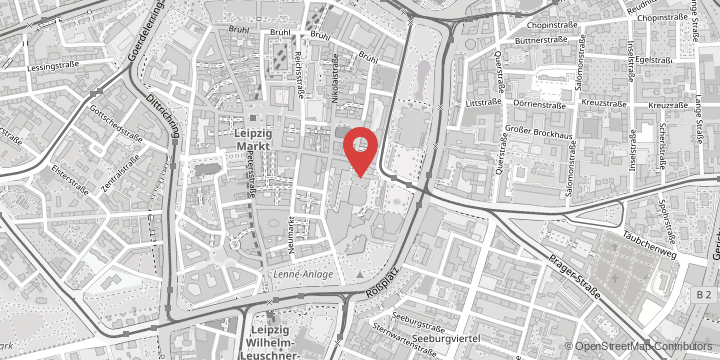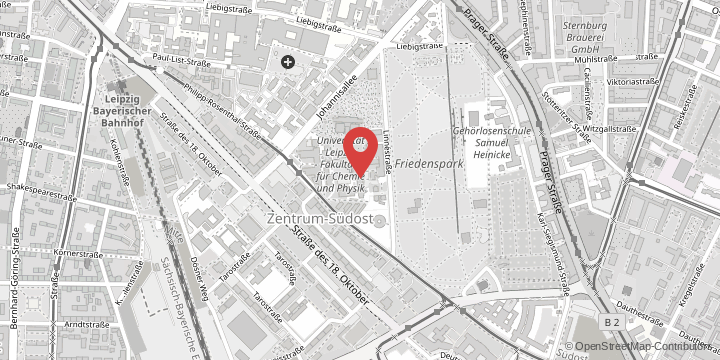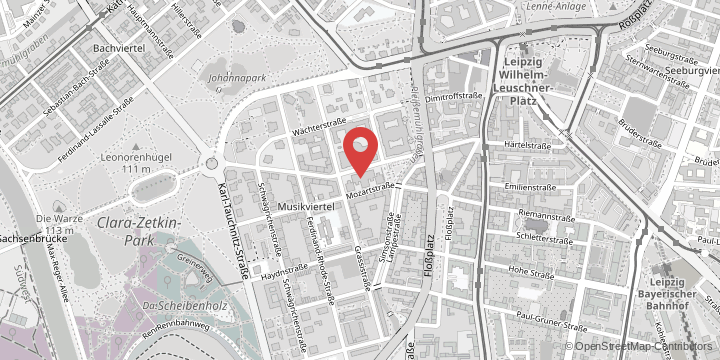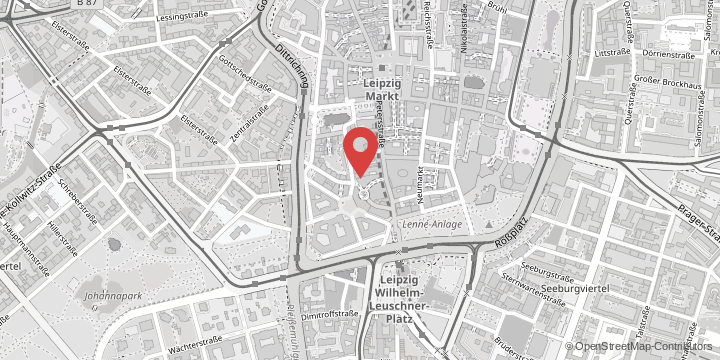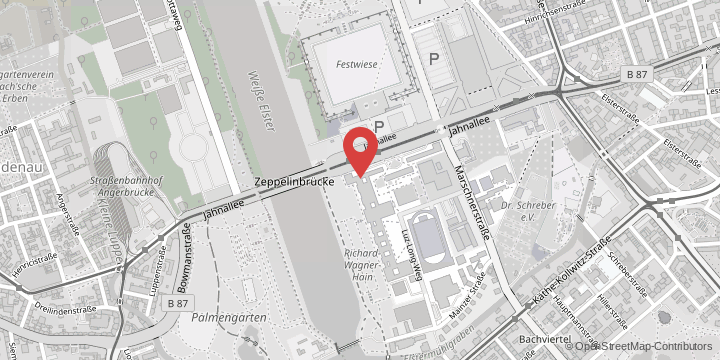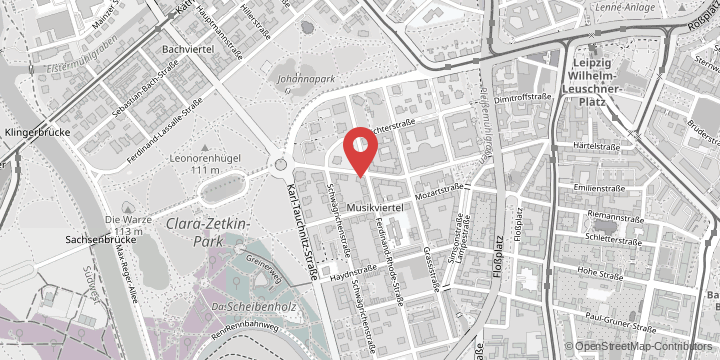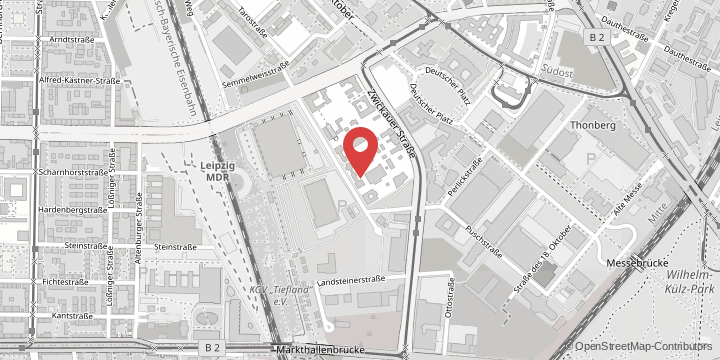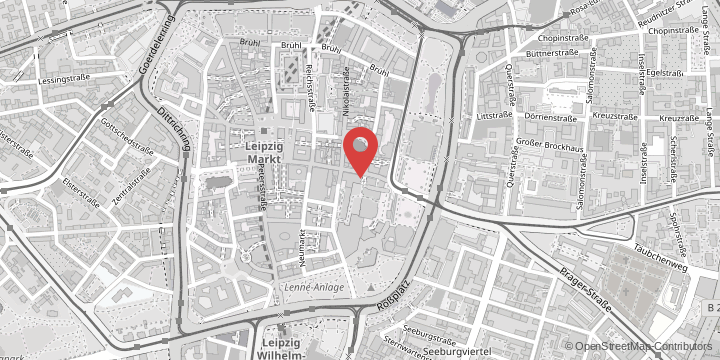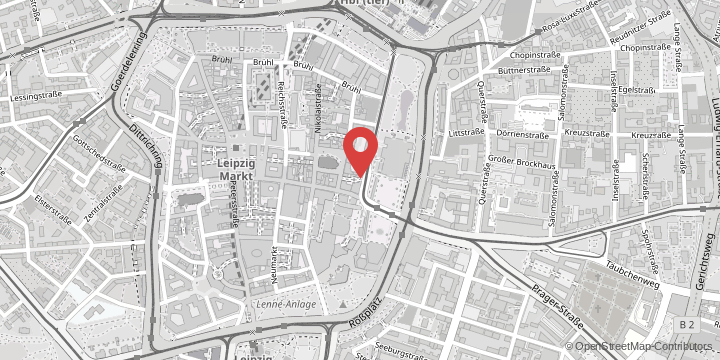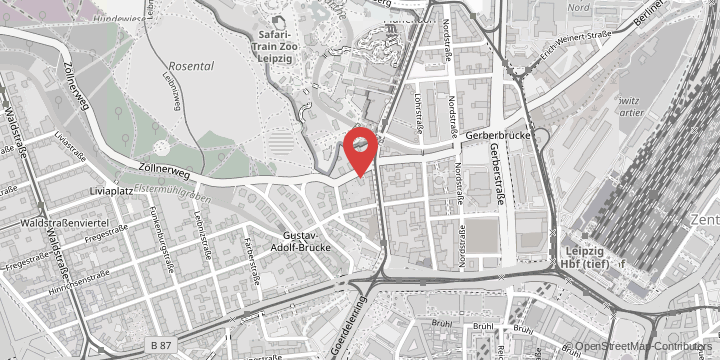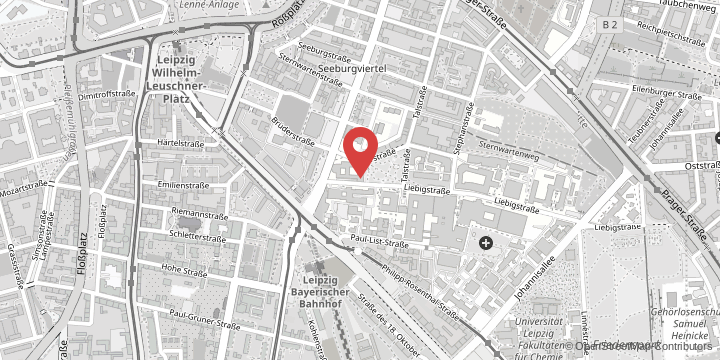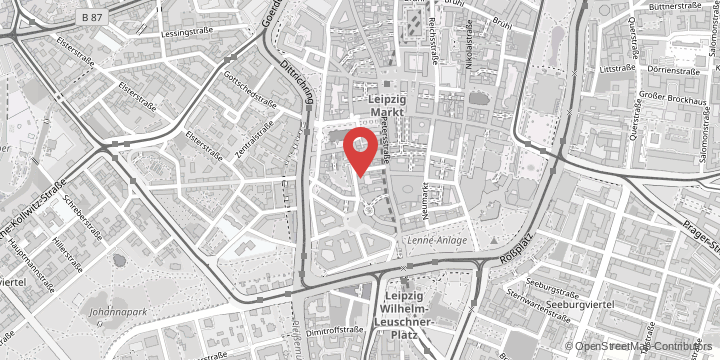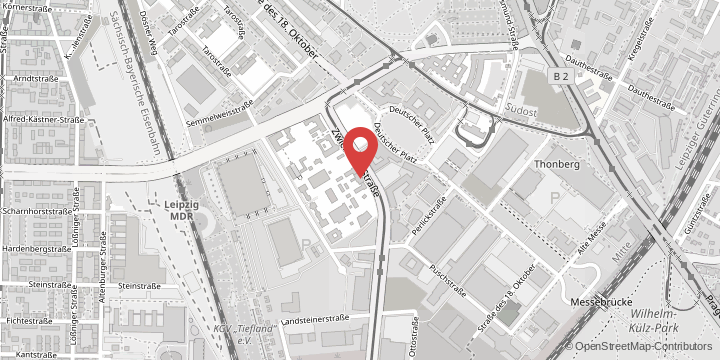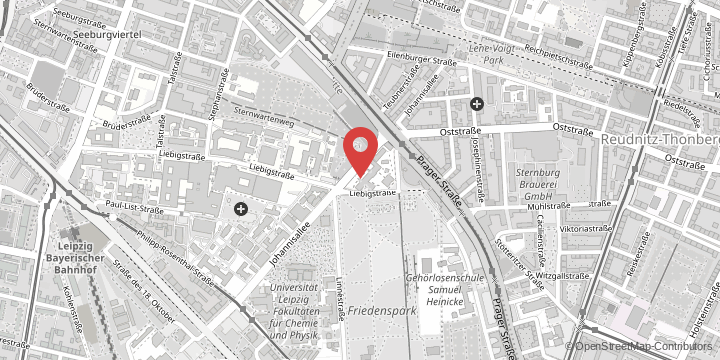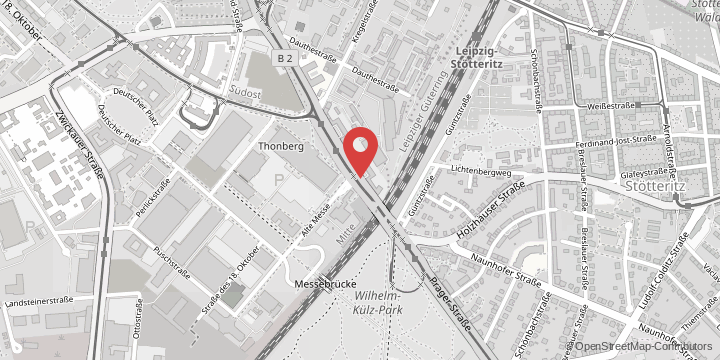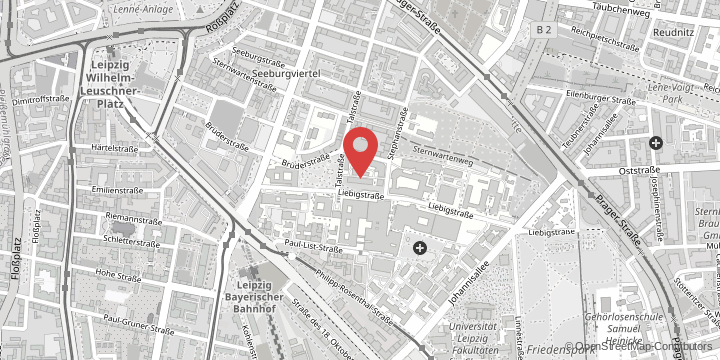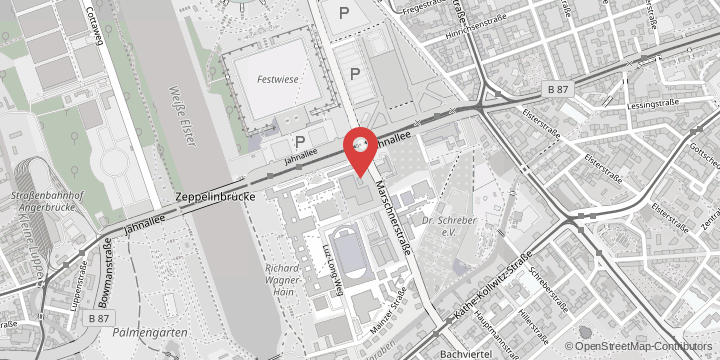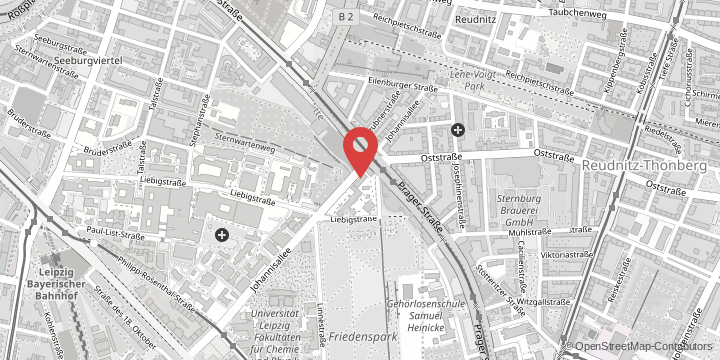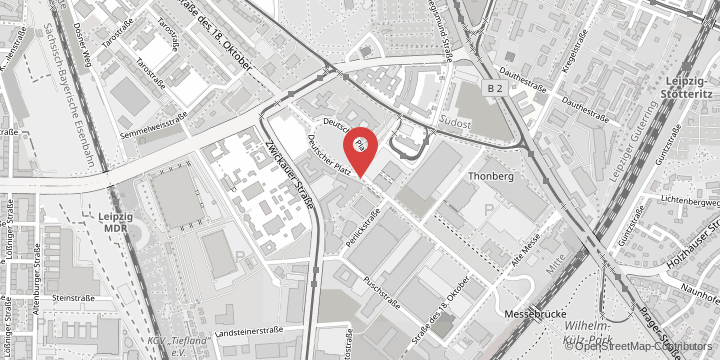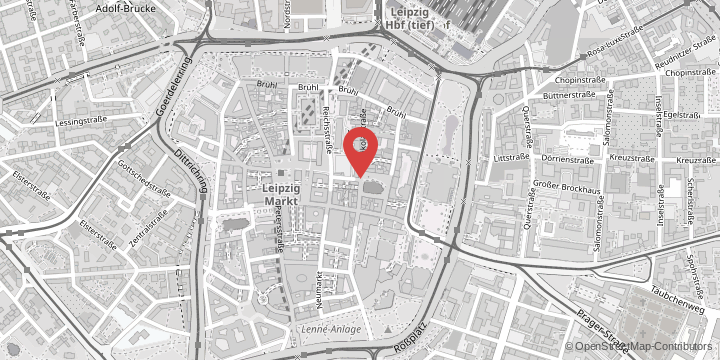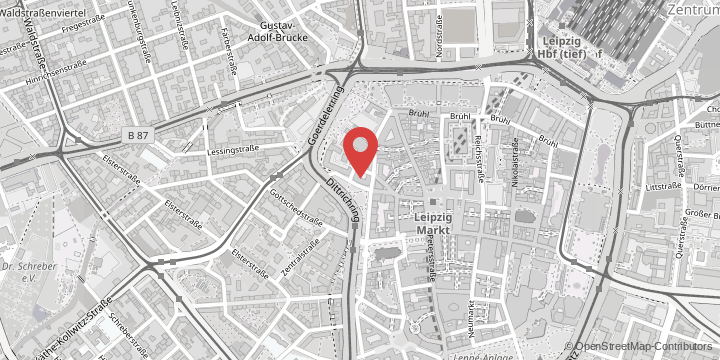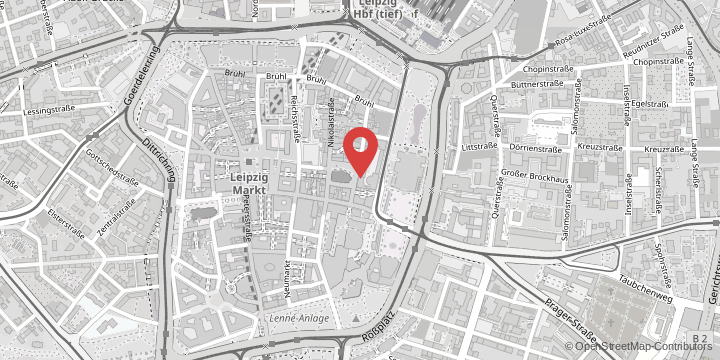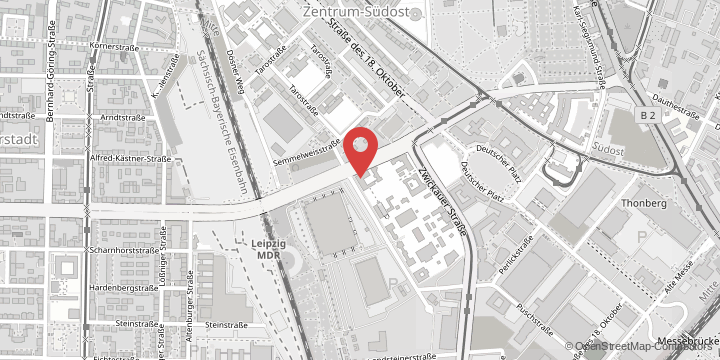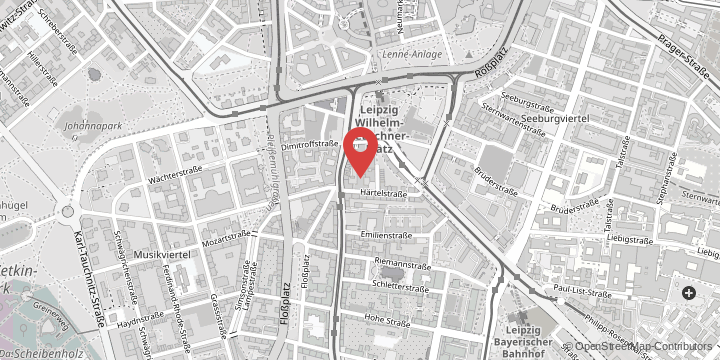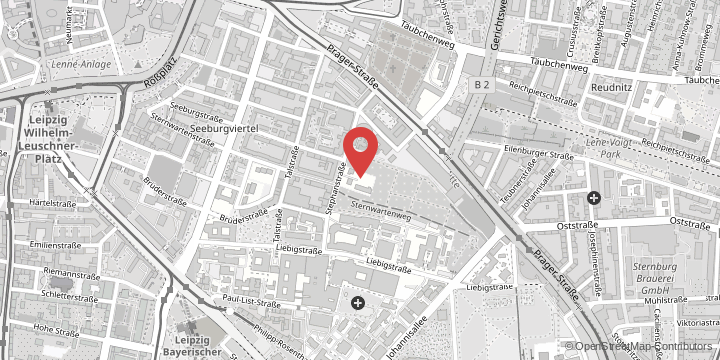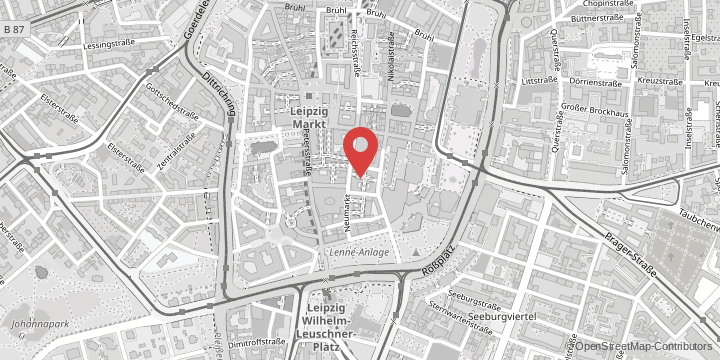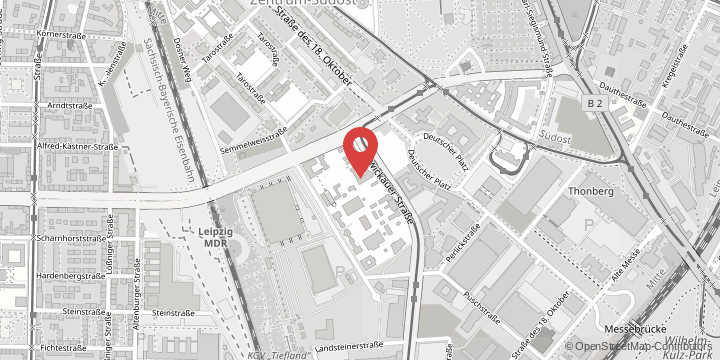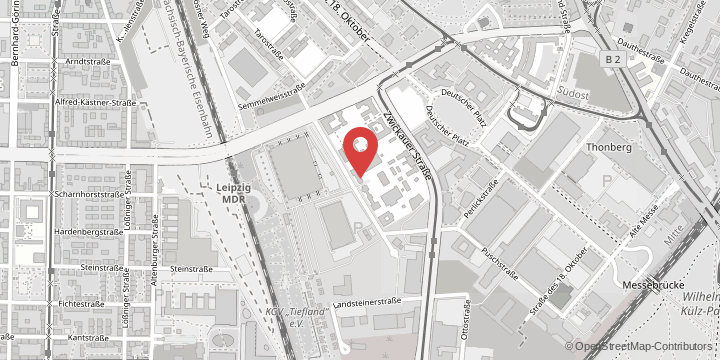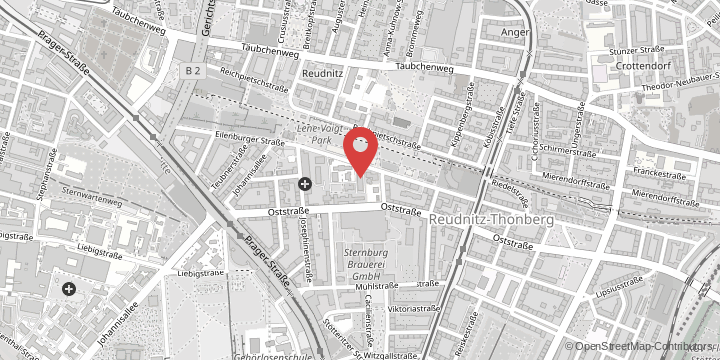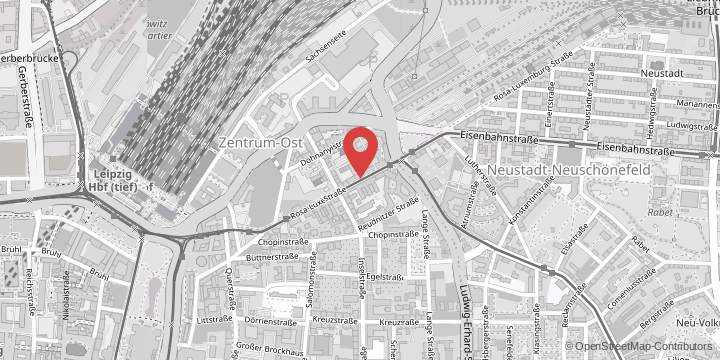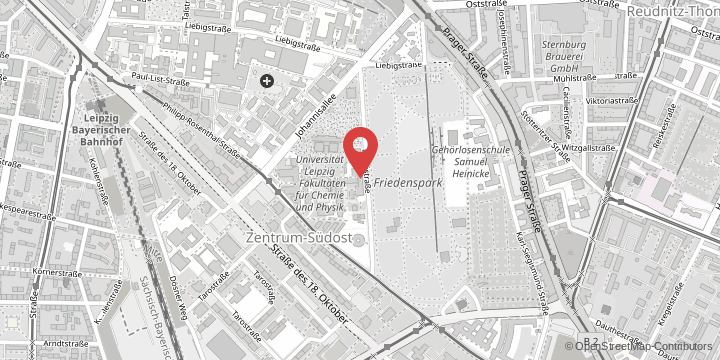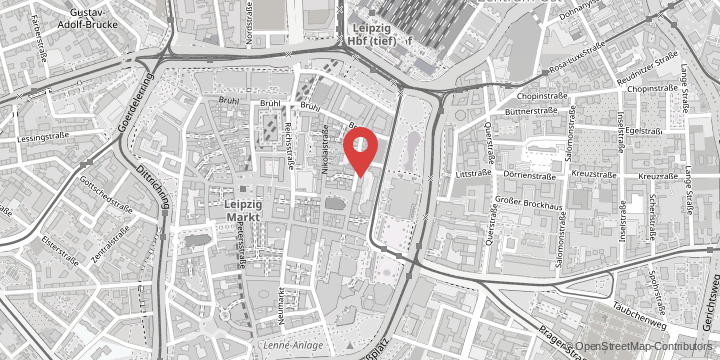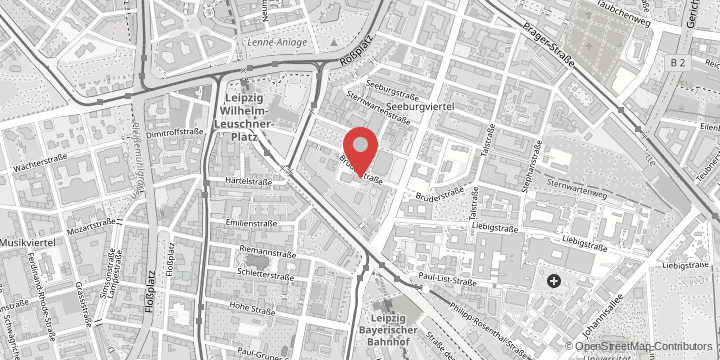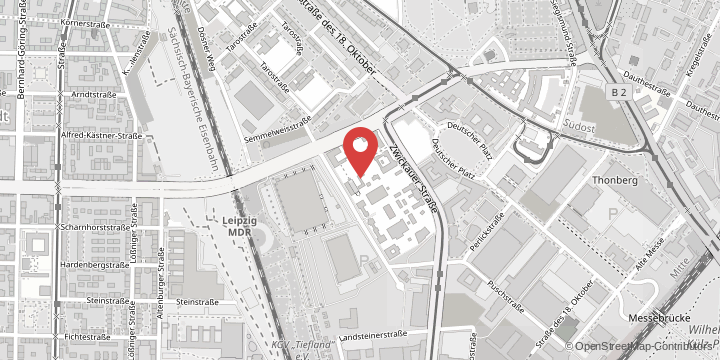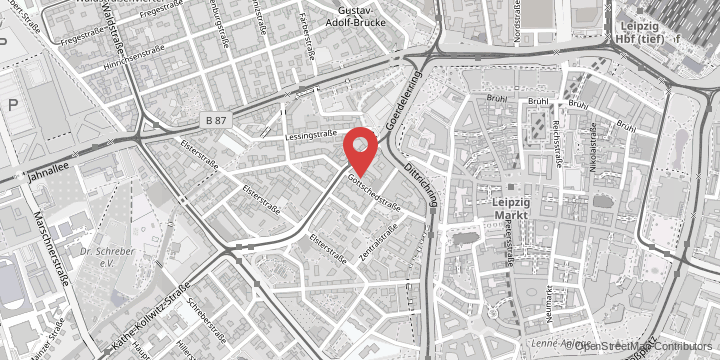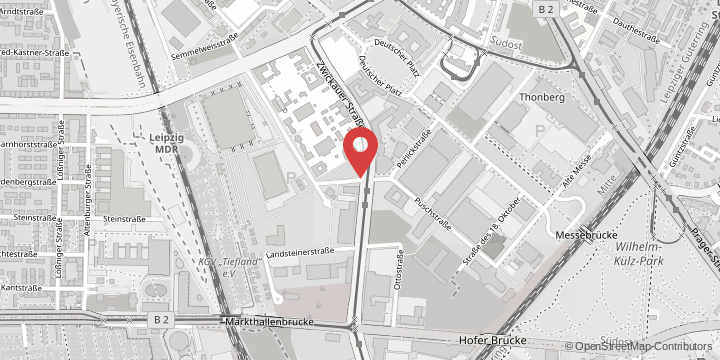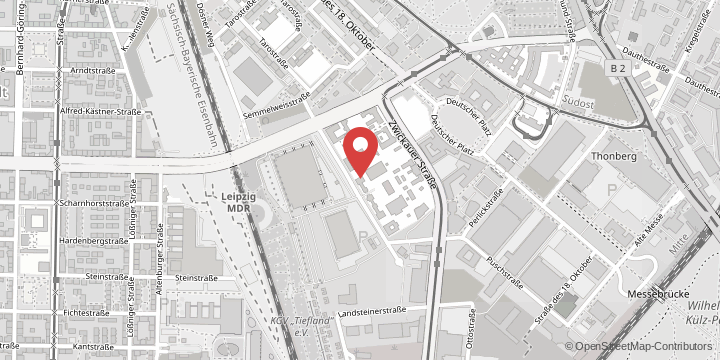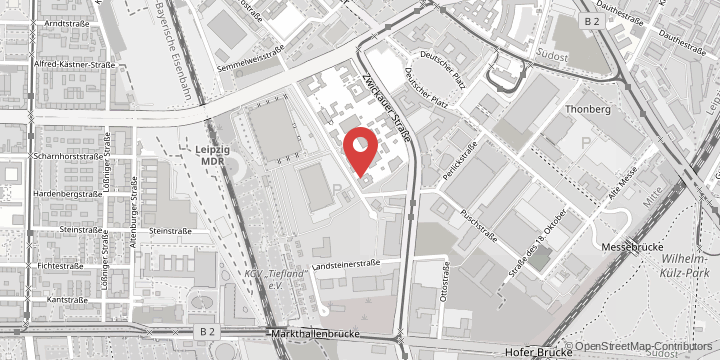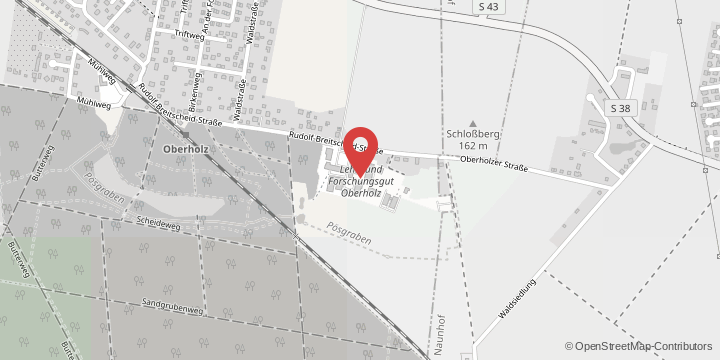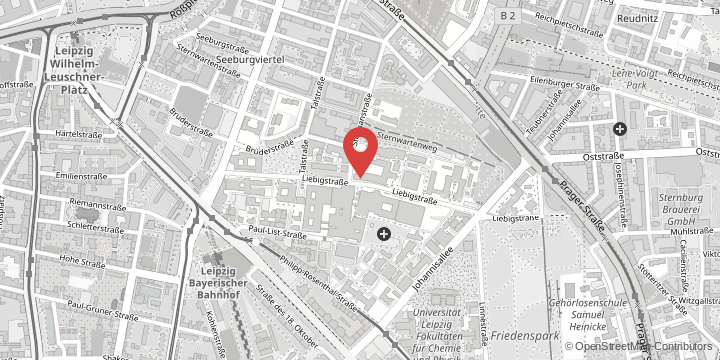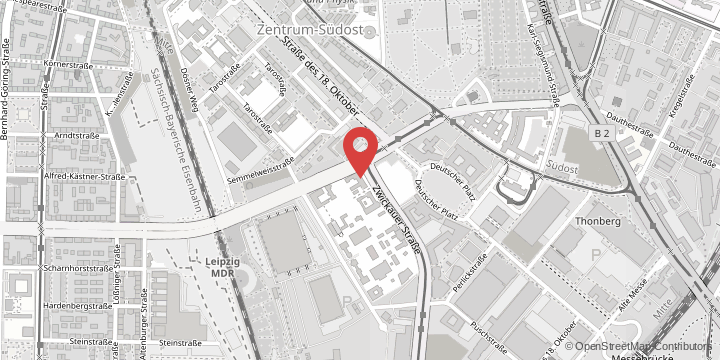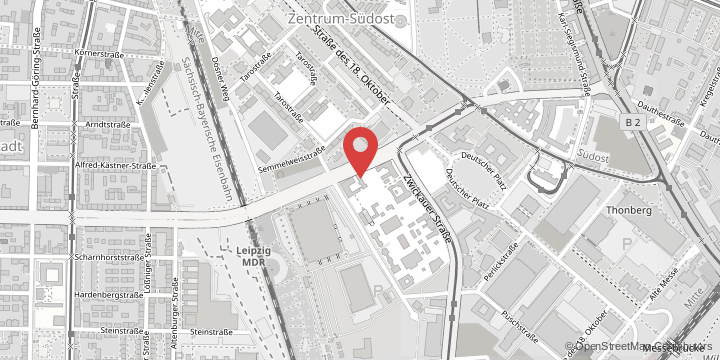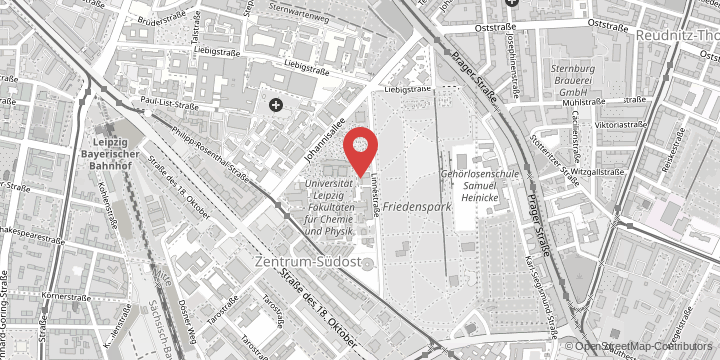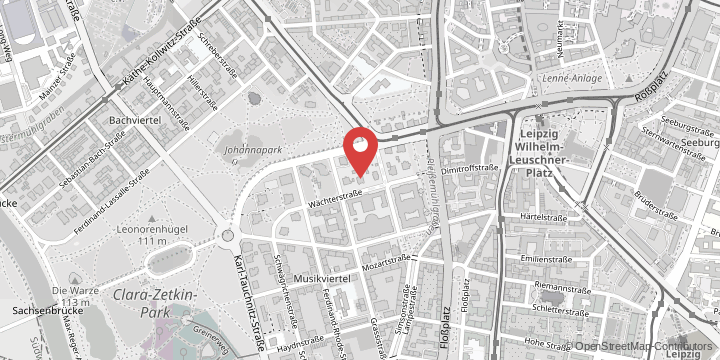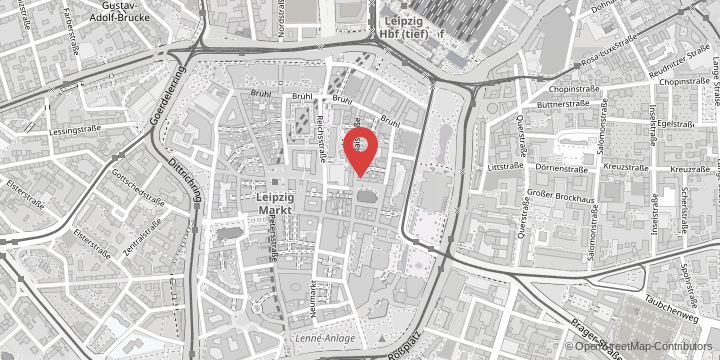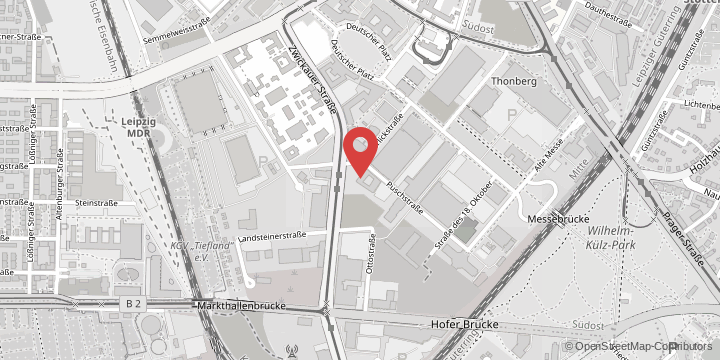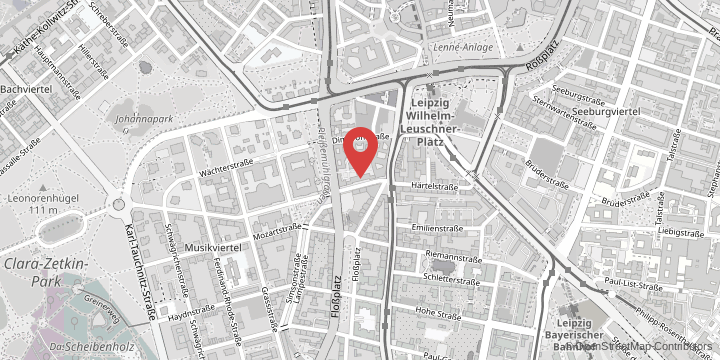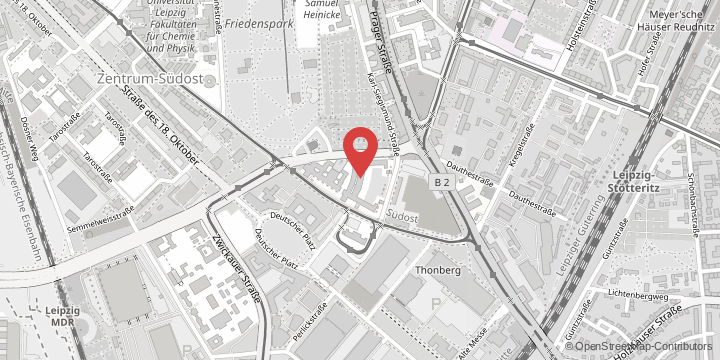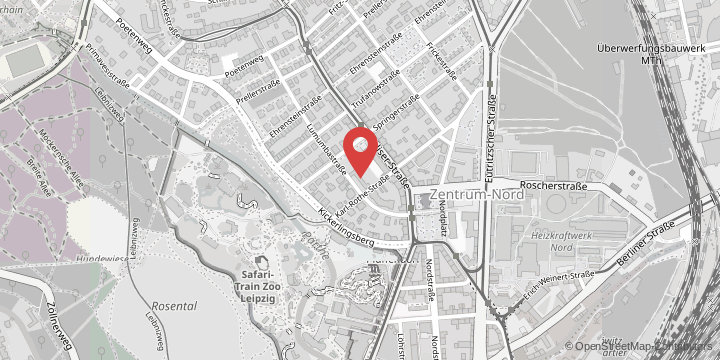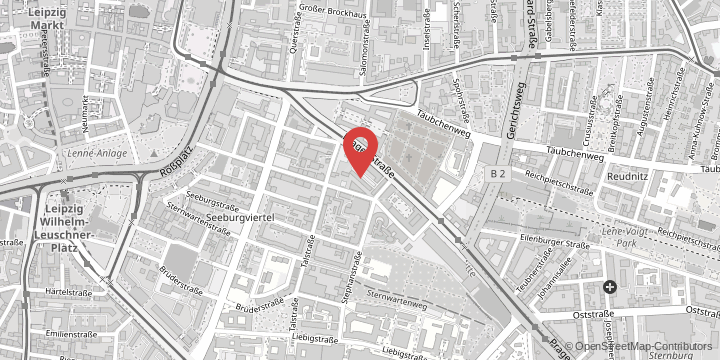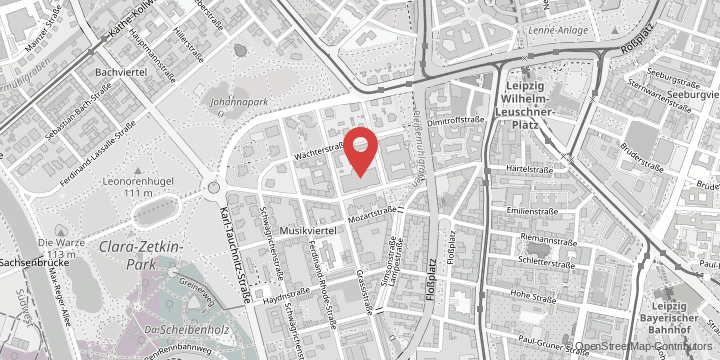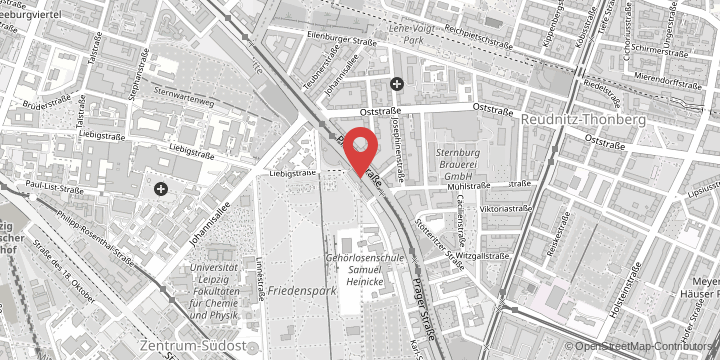10. Tag der Lehre widmete sich den "Skills for tomorrow"
Zum 10. Tag der Lehre am 22. Januar 2025, der erstmals lehrfrei war, waren alle Lehrenden und Studierenden der Universität Leipzig herzlich eingeladen. Einen ausführlichen Rückblick auf unsere Veranstaltung lesen Sie in unserem Newsbeitrag.
Präsentation 10. Tag der Lehre
PDF ∙ 316 KB
Universitäten sind in der führenden Verantwortung, Schlüsselkompetenzen in allen Fachbereichen zu fördern. Für Alumni sind sie genauso wichtig wie fachliche Kompetenzen, da sie einen integralen Bestandteil eines ganzheitlichen Bildungsweges darstellen und auf die Anforderungen einer herausfordernden und sich stetig weiter entwickelnden (Berufs-)Welt vorbereiten.
Seit Januar 2024 setzen sich im Rahmen des Prozesses „Skills for tomorrow – Disziplinen stärken. Diskurse öffnen. Denken weiten“ die Fakultäten der Universität Leipzig in einem partizipativen Diskurs mit dem Verhältnis von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Fachkulturen auseinander. Dies geschah mit Hinblick auf die Weiterentwicklung von Lehre und Studium, der Fachcurricula sowie der Fortschreibung und Aktualisierung des Leitbilds Lehre im Kontext universitätsweiter Strategieprozesse.
Im bisherigen Verlauf der Diskussion haben die Fächer und Fakultäten sich auf sechs Themenfelder verständigt, die als Gegenstand in Lehre und Studium künftig stärker akzentuiert und an denen insbesondere die Vermittlung überfachlicher Kompetenzen ausgerichtet werden soll:
- Nachhaltigkeit
- Demokratiebildung
- Diversität
- Data und Digital Literacy
- Entrepreneurship und Selbstständigkeit
- Sprachen- und Kulturkompetenz.
Rückblick auf 10 Jahre „Tag der Lehre”
Seit mittlerweile zehn Jahren steht der Tag der Lehre an der Universität Leipzig im Zeichen des Austauschs, der Innovation und der gemeinsamen Weiterentwicklung von Lehre und Lernen. In unserem Fotorückblick nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch ein Jahrzehnt voller inspirierender Impulse, engagierter Diskussionen und lebendiger Lehrkultur.
Fotorückblick
PDF ∙ 5 MB