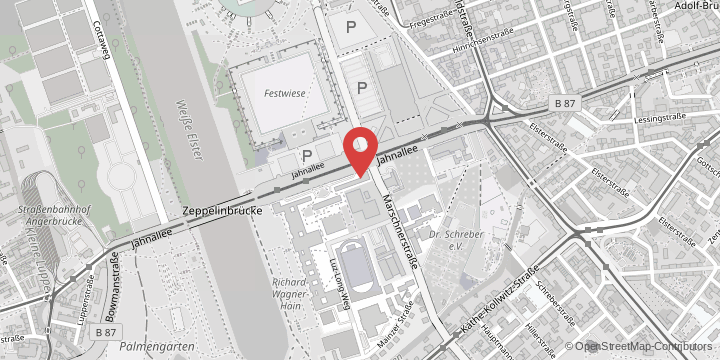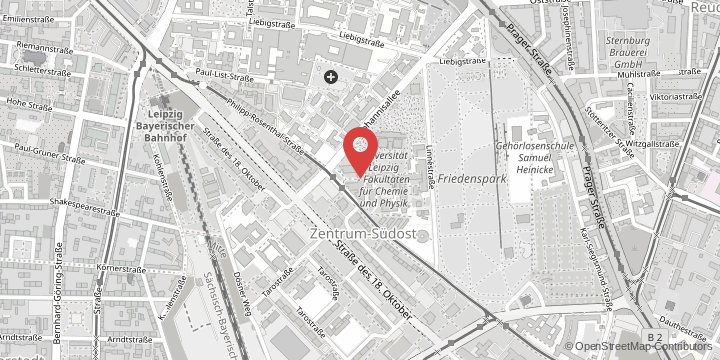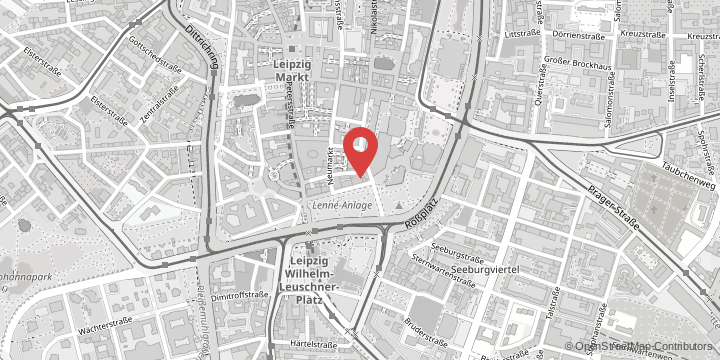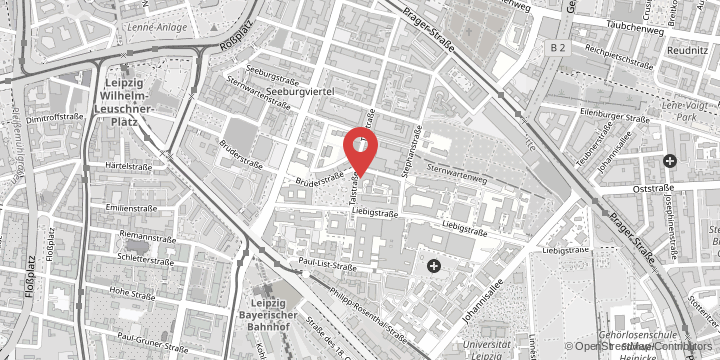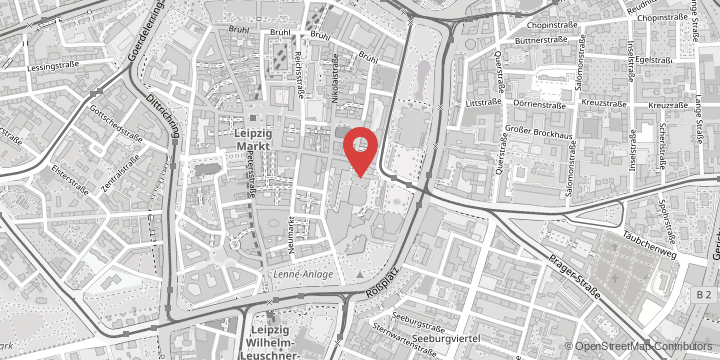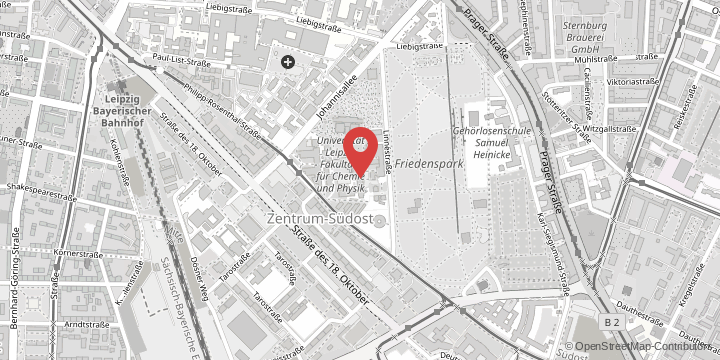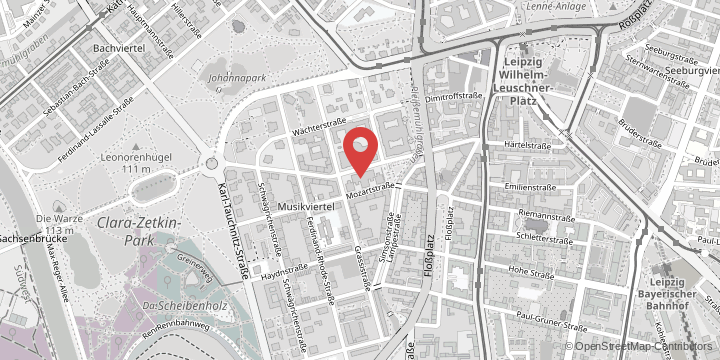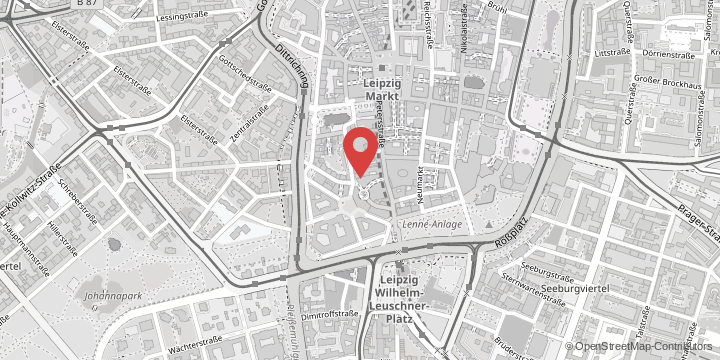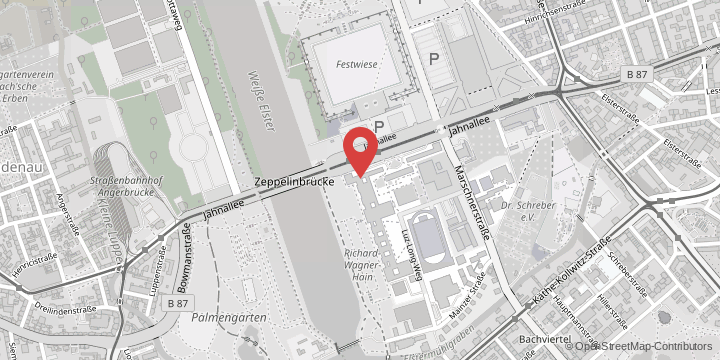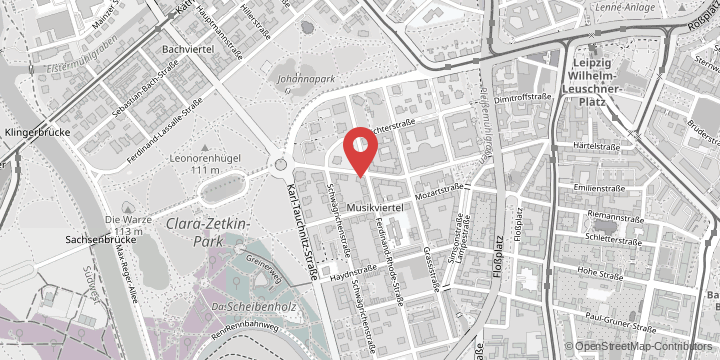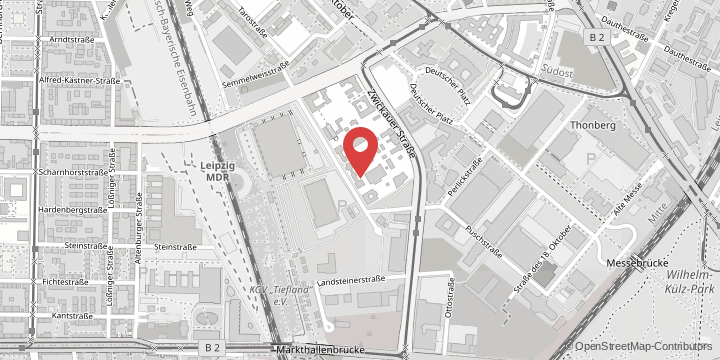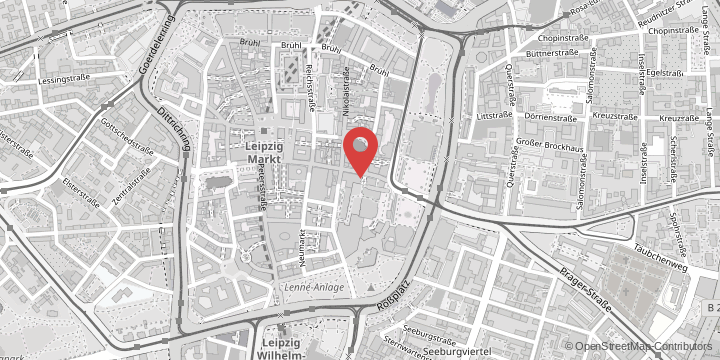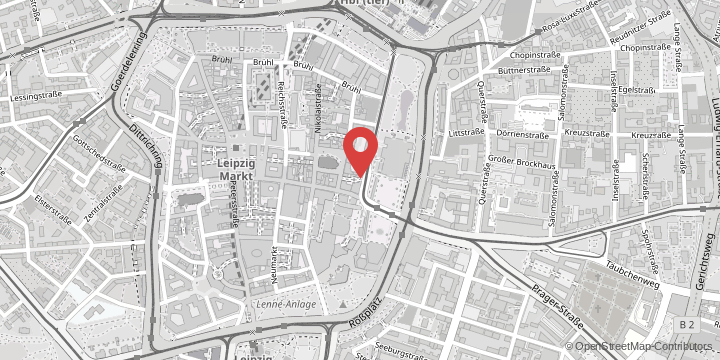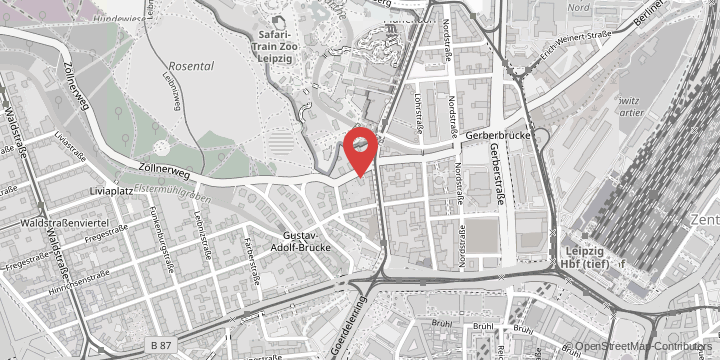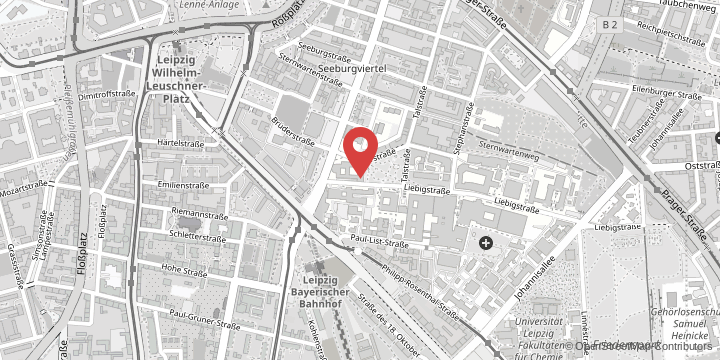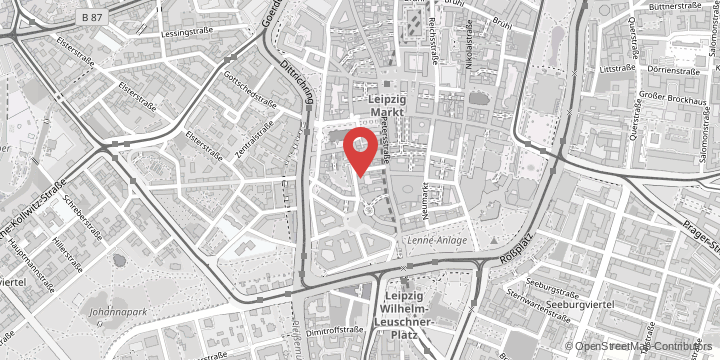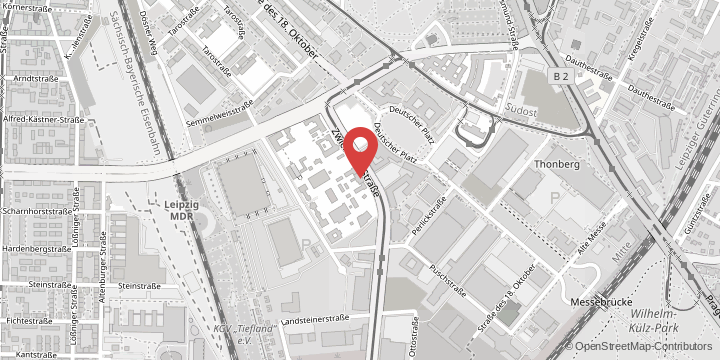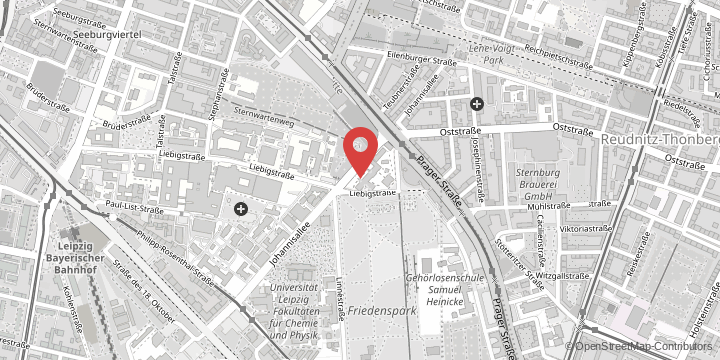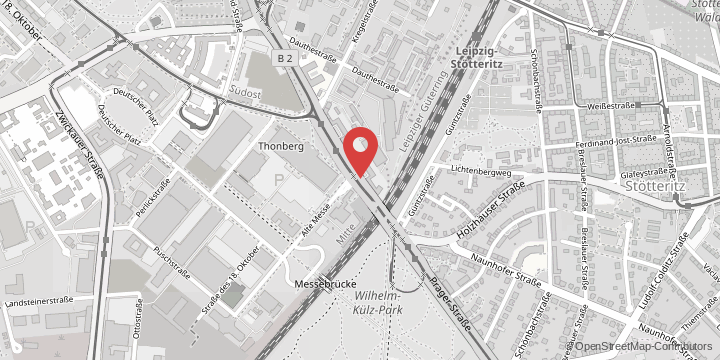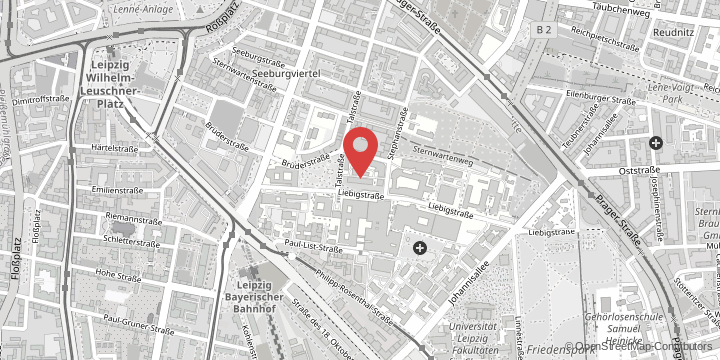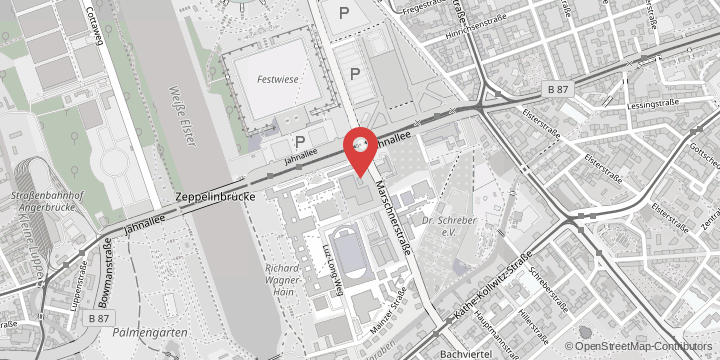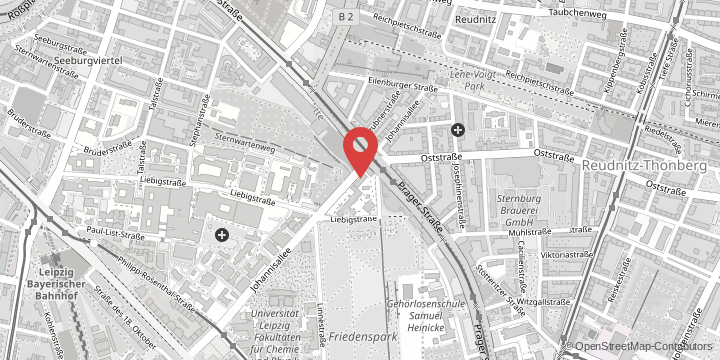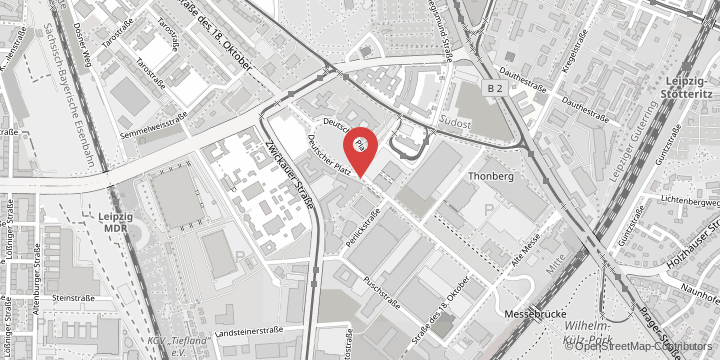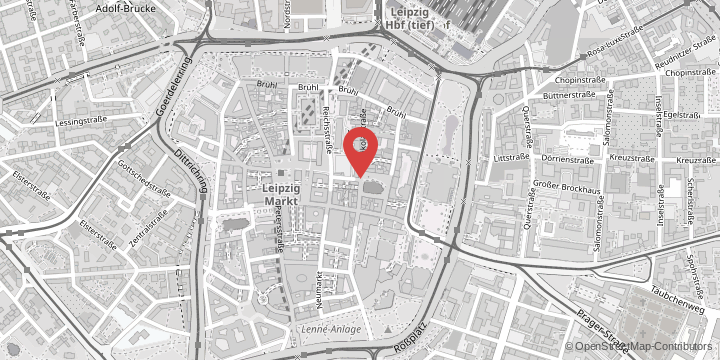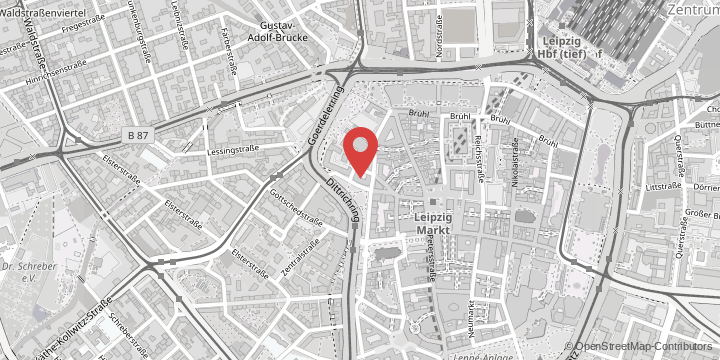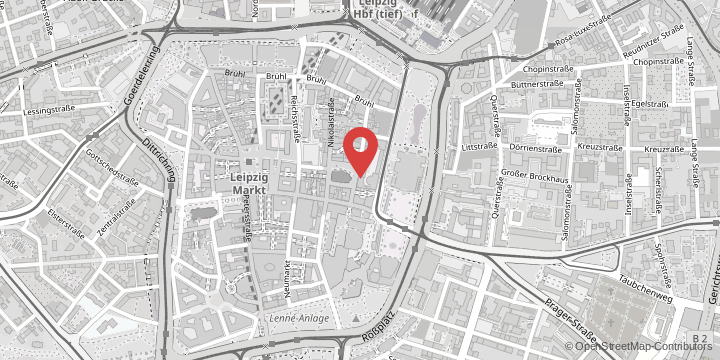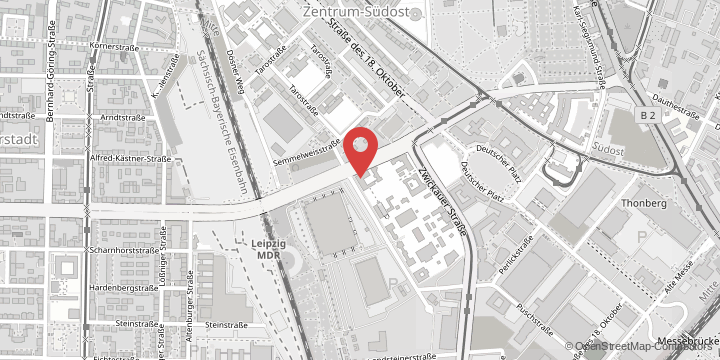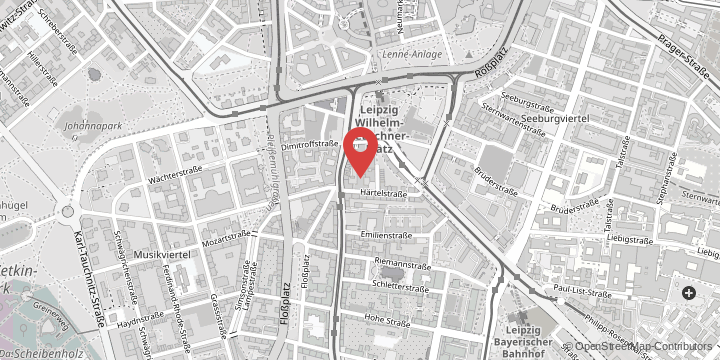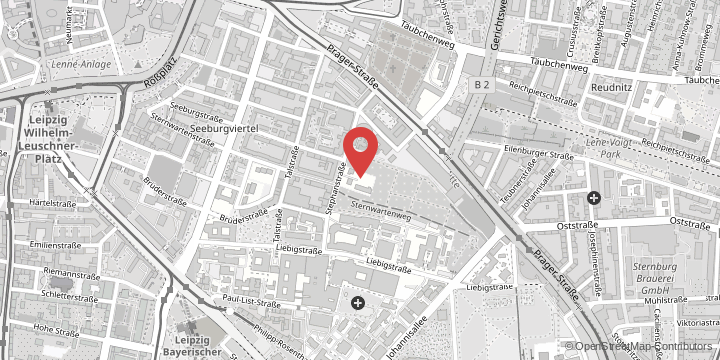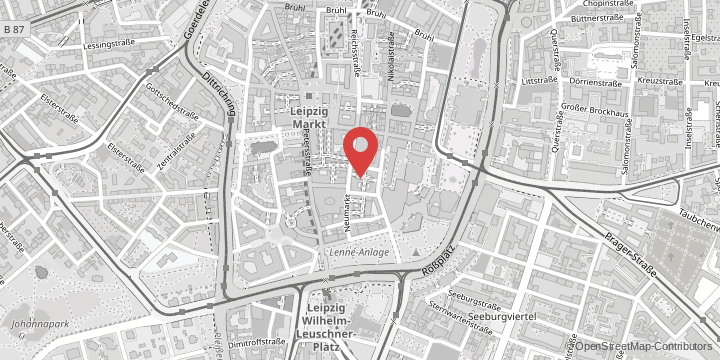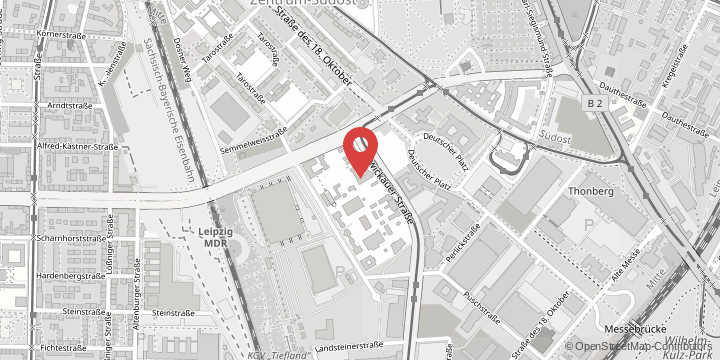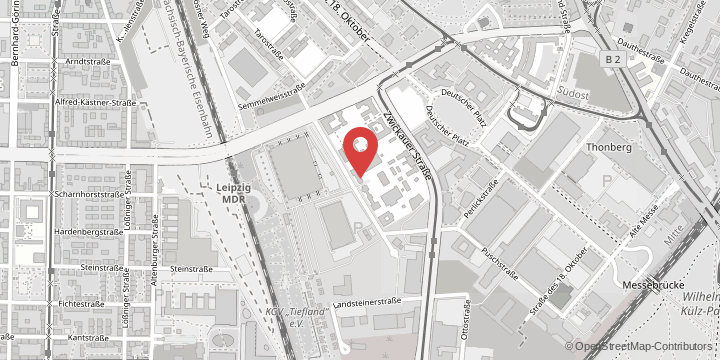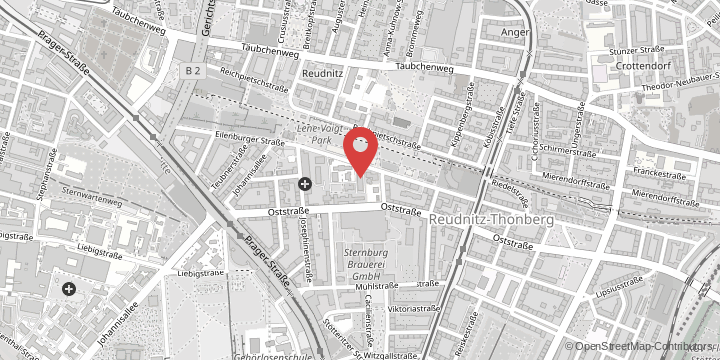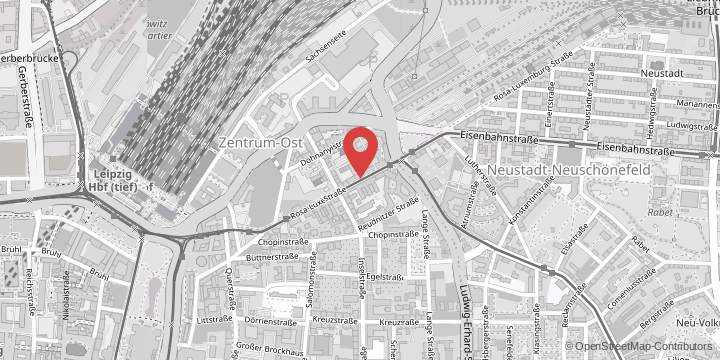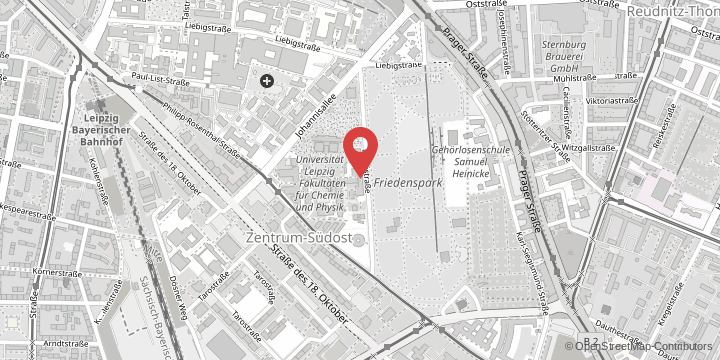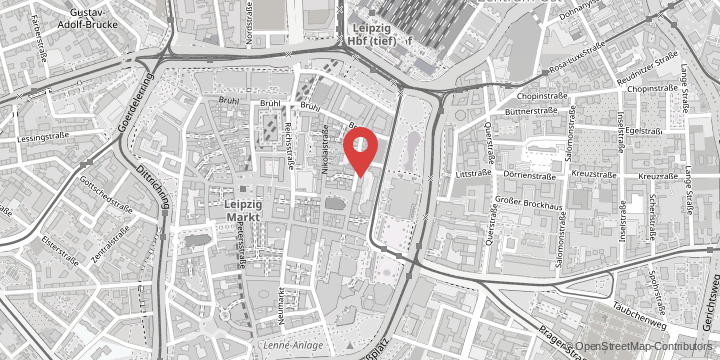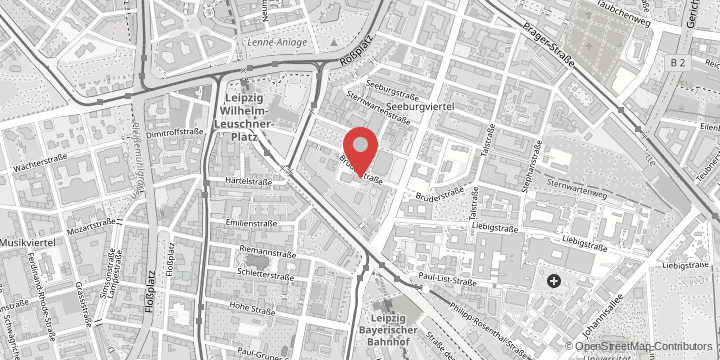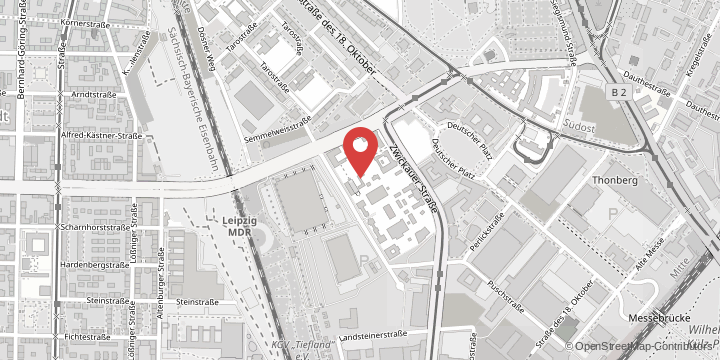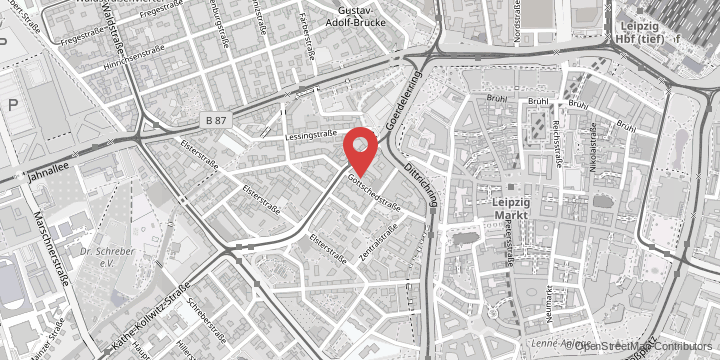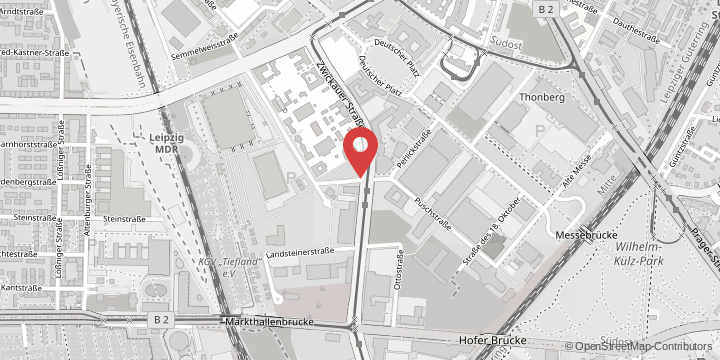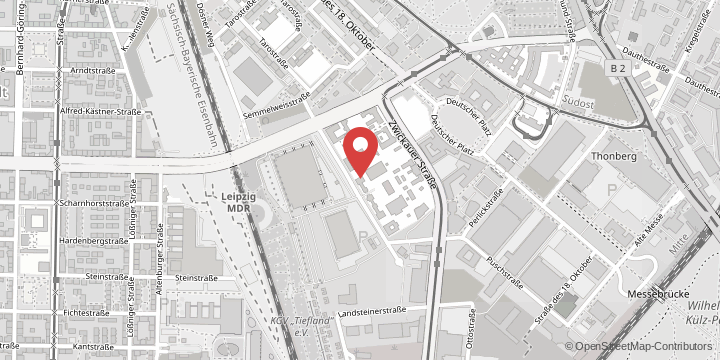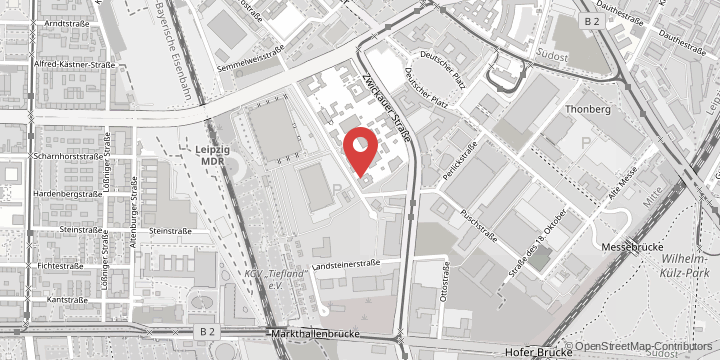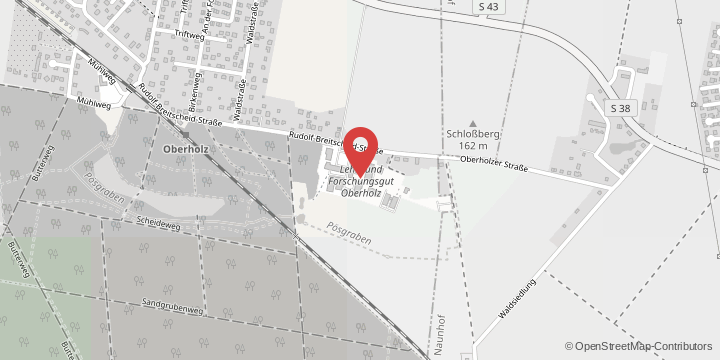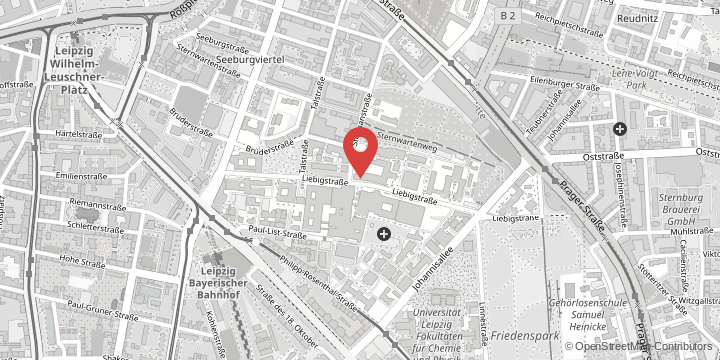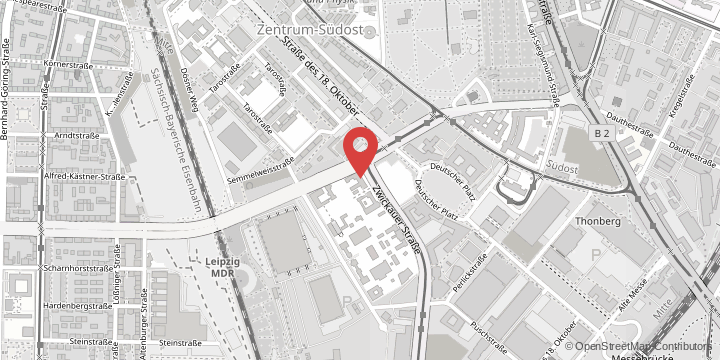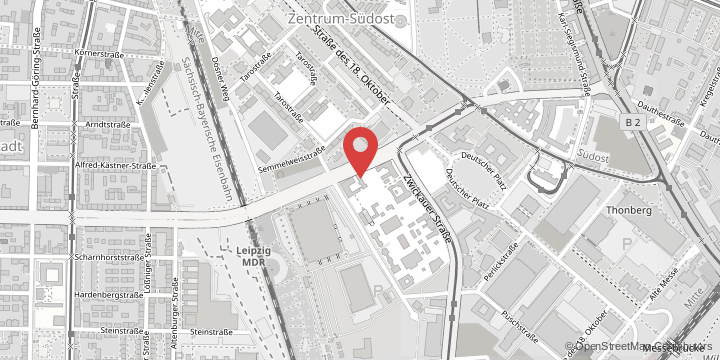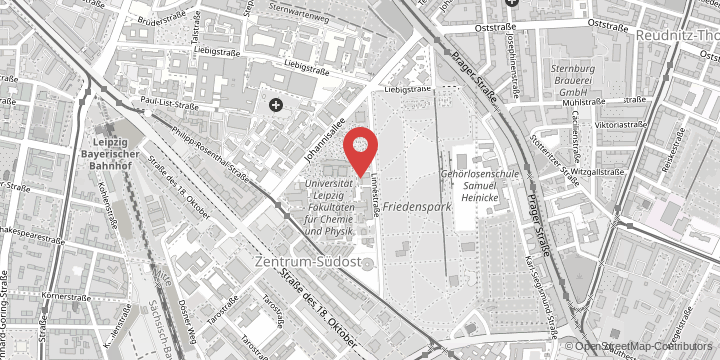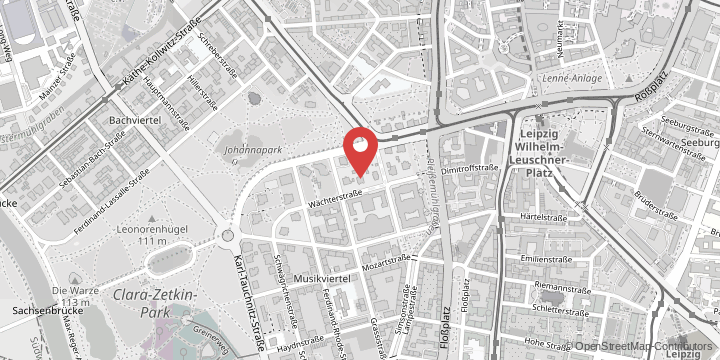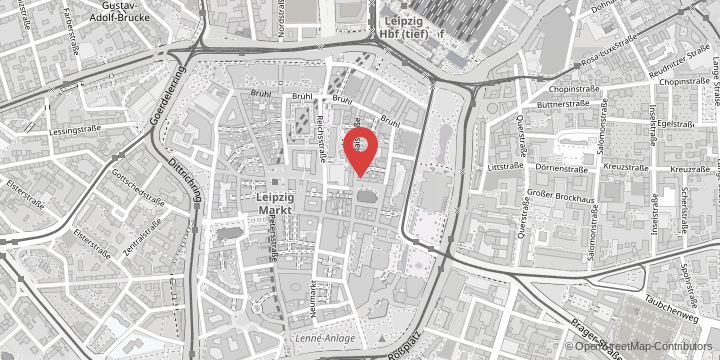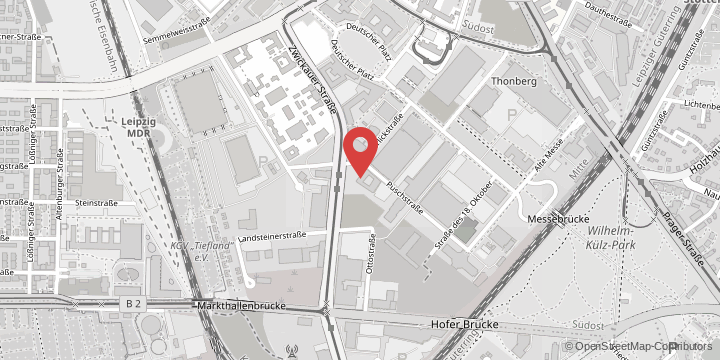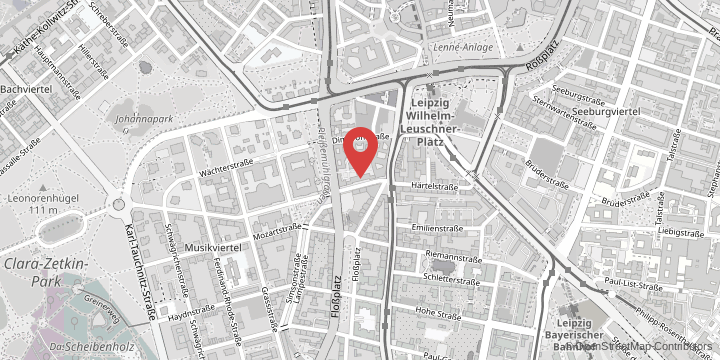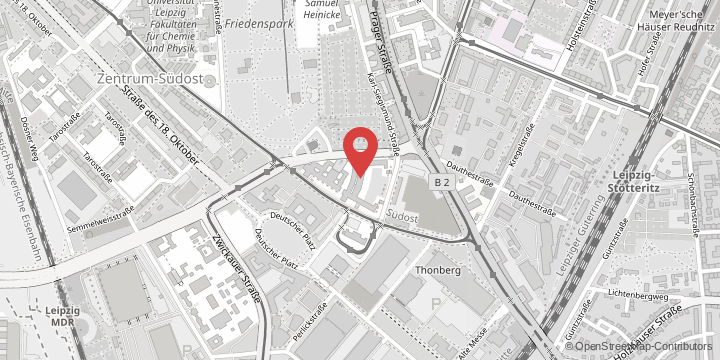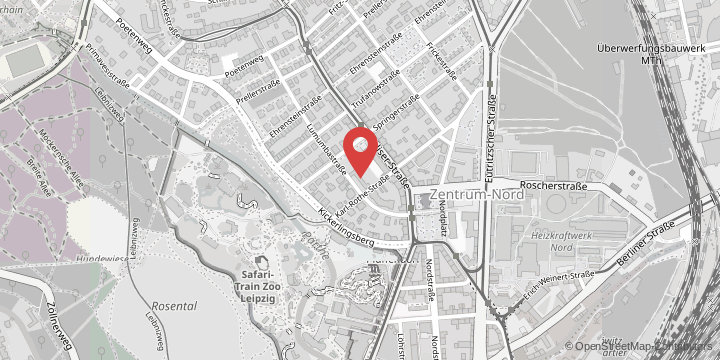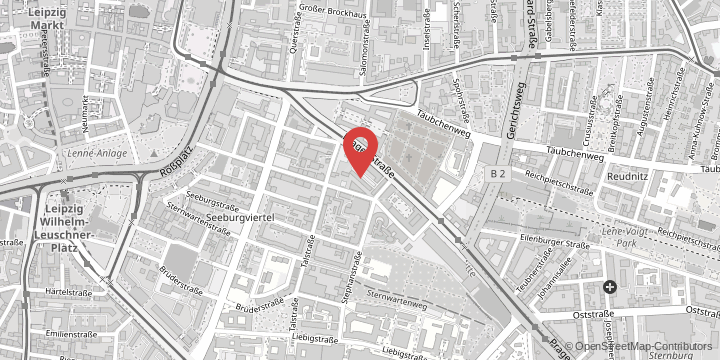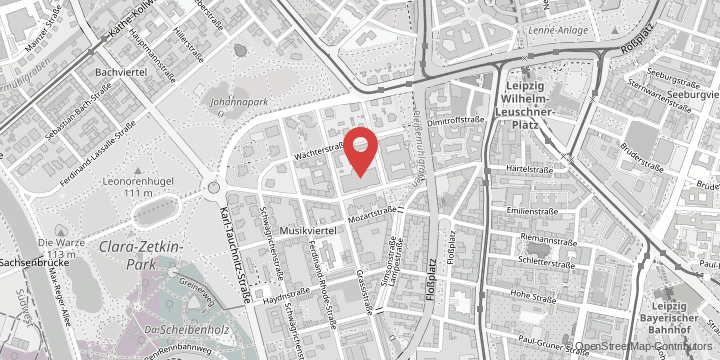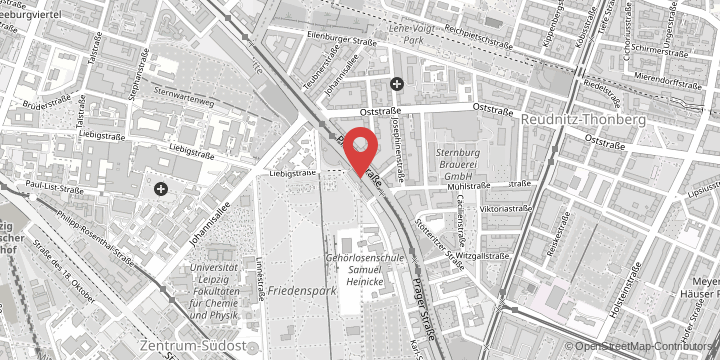Die akkadische Sprache starb vor rund 2000 Jahren aus. Wieso ist es wichtig, ein neues Wörterbuch zu dieser Sprache zu erstellen?
Prof. Dr. Michael Streck: Akkadisch ist die bedeutendste Sprache des Alten Orients, einer Epoche der Menschheitsgeschichte im Nahen Osten vom 4. Jahrtausend vor Christus bis zur Entstehung des Islams im 7. Jahrhundert nach Christus. Gesprochen und geschrieben wurde Akkadisch vor allem in den Reichen Babyloniens und Assyrien, zusammengefasst als Mesopotamien, heute die Länder Irak und Syrien; die Sprache heißt daher auch Babylonisch-Assyrisch. Zum Schreiben gebrauchte man damals die Keilschrift, welche auf kleinen Tontafeln eingedrückt wurde.
Was kaum jemand weiß: Die akkadischen Schriftzeugnisse sind zahlreicher als die des antiken Latein. Akkadisch ist nach dem Altgriechischen die zweithäufigste Sprache des Altertums!
Die vorliegenden akkadischen Wörterbücher sind veraltet; viele Wörter fehlen in ihnen oder sind nicht richtig gedeutet. Viele Keilschrifttexte waren noch gar nicht bekannt, als man diese Bücher zusammenstellte. Die Wissenschaft braucht also ein neues Wörterbuch, um akkadische Texte auf dem aktuellen Stand übersetzen zu können, denn sie sind unsere Hauptquelle für die Erforschung der Geschichte und Kulturen des Alten Orients.
Welche modernen Methoden und Technologien nutzen Sie, die für bisherige Wörterbücher des Akkadischen noch nicht zur Verfügung standen?
Die bisher in der Altorientalistik benutzten Wörterbücher bestehen aus vielen gedruckten Bänden. Ihre Herausgeber arbeiteten noch mit Karteikarten und Zettelkästen. Die Nachteile dieser Bücher sind zahlreich: umständlich zu benutzen, schwer upzudaten, teuer. Es liegt daher nahe, sich moderner Informationstechnologie zu bedienen.
Das Leipzig Akkadian Dictionary wird als frei zugängliche Onlinedatenbank entstehen. Jeder wird es kostenlos nutzen können. Suchfunktionen werden es erlauben, in Sekundenschnelle ein Wort, seine Übersetzung und sein Vorkommen in verschiedenen Texten zu finden. Links werden das Wörterbuch mit digitalen und online veröffentlichten Sammlungen von Keilschrifttexten verknüpfen. Nicht zuletzt wird es immer leicht möglich sein, Korrekturen und Zusätze einzuarbeiten, denn unser Wissensstand verbessert sich laufend.
Übrigens werden die älteren gedruckten Wörterbücher digitalisiert und in das Leipzig Akkadian Dictionary eingebunden werden.
Mit 17 Jahren Laufzeit handelt es sich beim „Leipzig Akkadian Dictionary“ um ein echtes Langzeitprojekt. Was macht diese Forschung so zeitintensiv?
In den letzten Jahrzehnten wurden der Wissenschaft Zehntausende neuer Keilschrifttexte bekannt, die bislang unübersetzt in Museumskellern lagerten oder bei archäologischen Grabungen im Nahen Osten gefunden wurden und in keinem Wörterbuch berücksichtigt wurden.
Die Hauptaufgabe des kleinen Wörterbuchteams wird es sein, diese vielen Texte zu lesen, zu übersetzen und wie ein Detektiv nach neuen Wörtern zu fahnden, neue Bedeutungen bereits bekannter Wörter zu erkennen und der Geschichte eines jeden Wortes in den Keilschrifttexten nachzuspüren. Von der einfachen Quittung bis zur Sintfluterzählung kann es sich dabei um alle möglichen, manchmal auch schwierig zu verstehenden, Textsorten handeln.
Das Leipzig Akkadian Dictionary wird ein Belegwörterbuch sein: Die akkadischen Wörter werden nicht nur in mehrere Sprachen übersetzt (Englisch, Deutsch, Französisch und Arabisch sind geplant), sondern es wird auch gezeigt, in welchen Texten und Zusammenhängen sie vorkommen. Ein solches Wörterbuch ist ein großes wissenschaftliches Unterfangen.