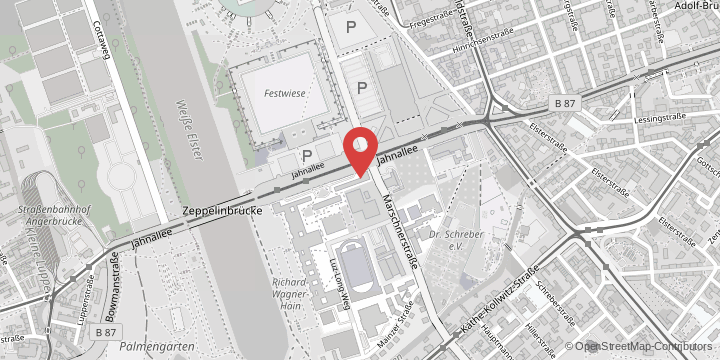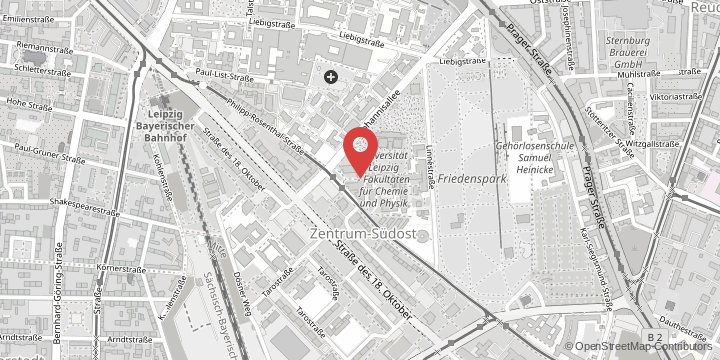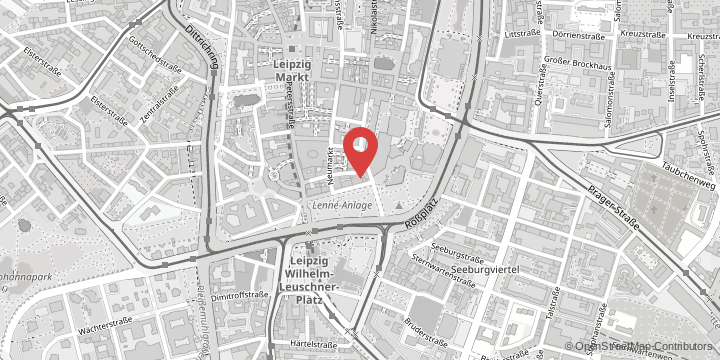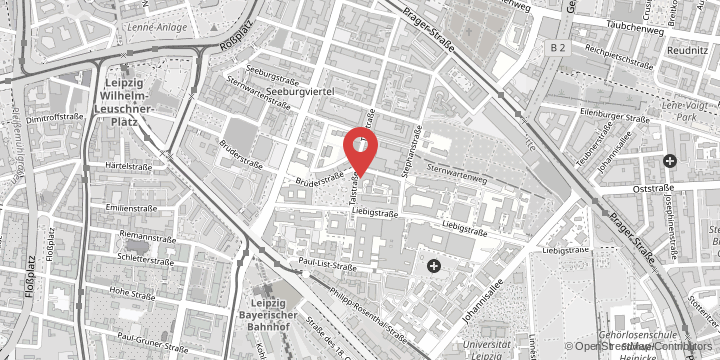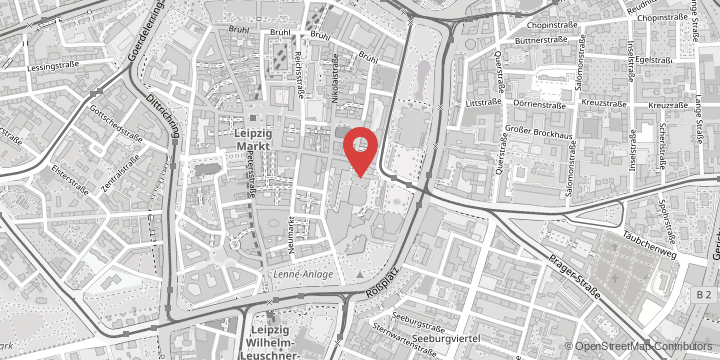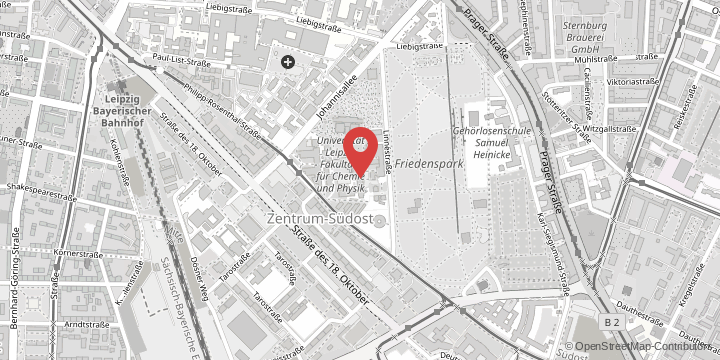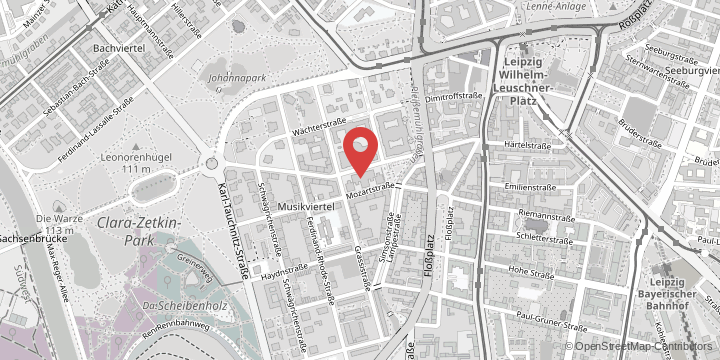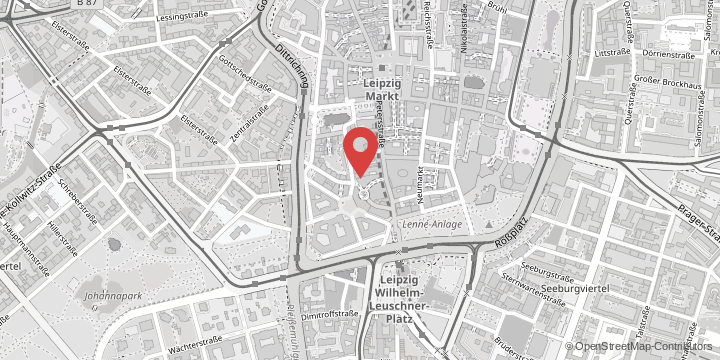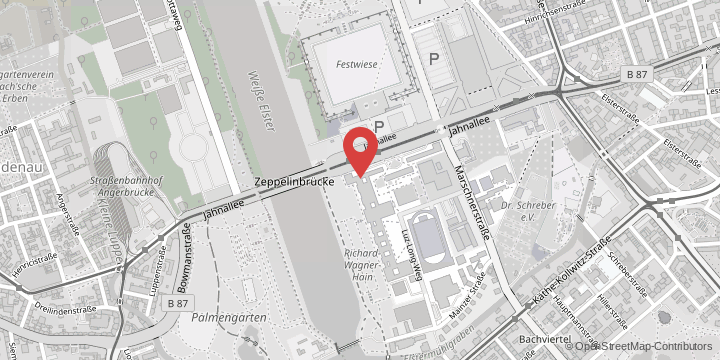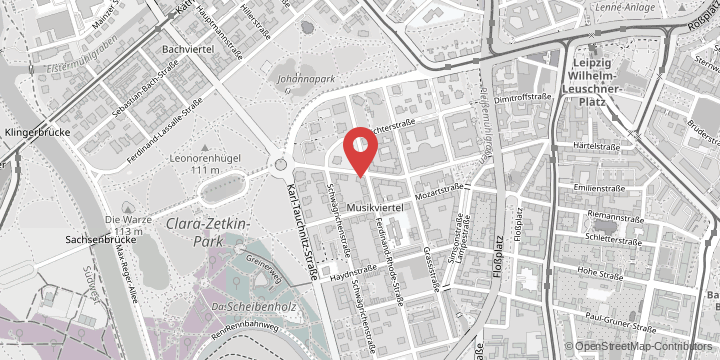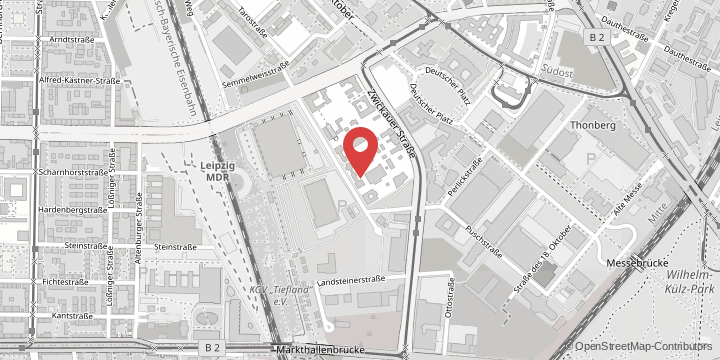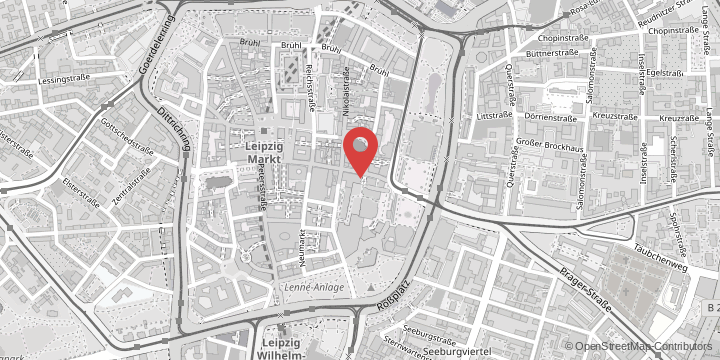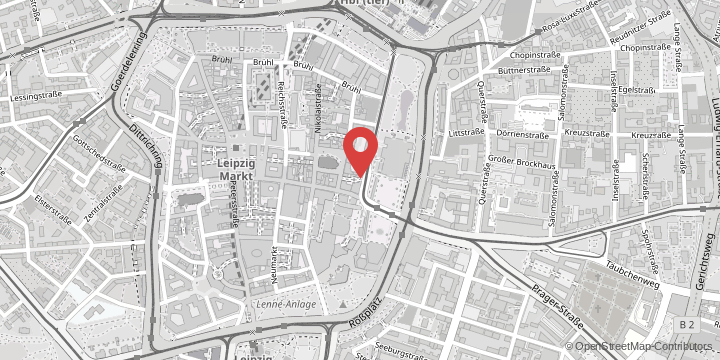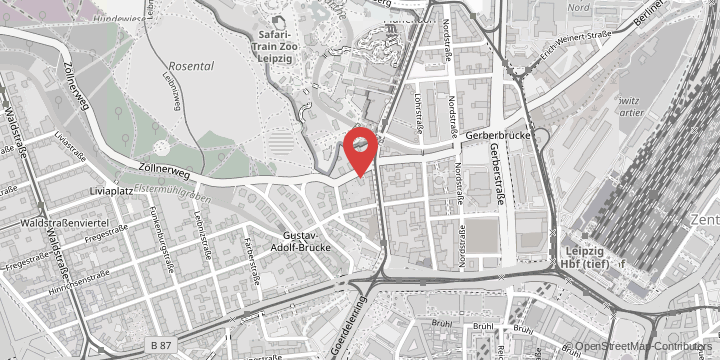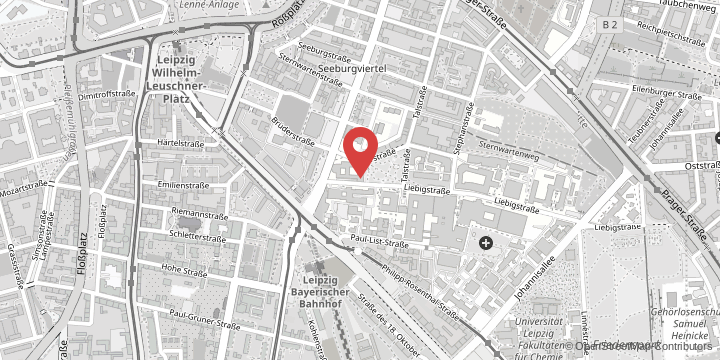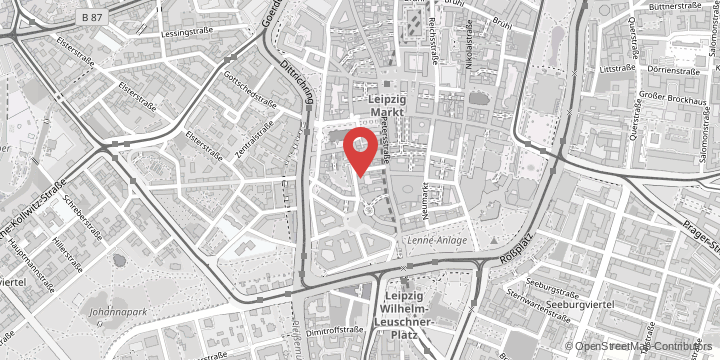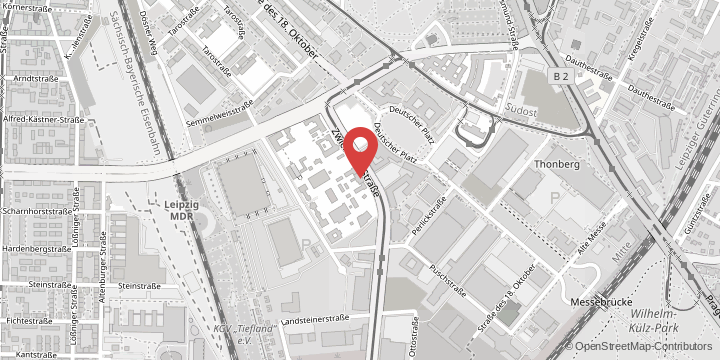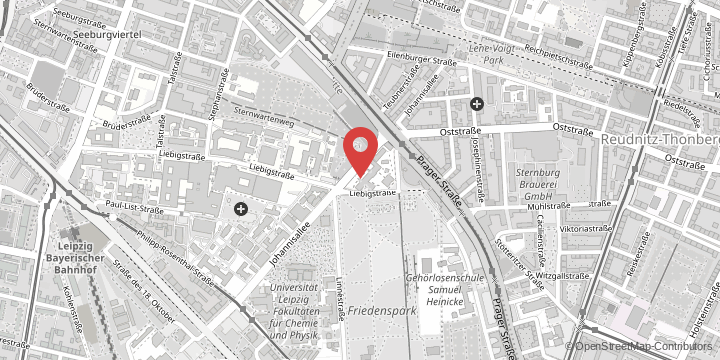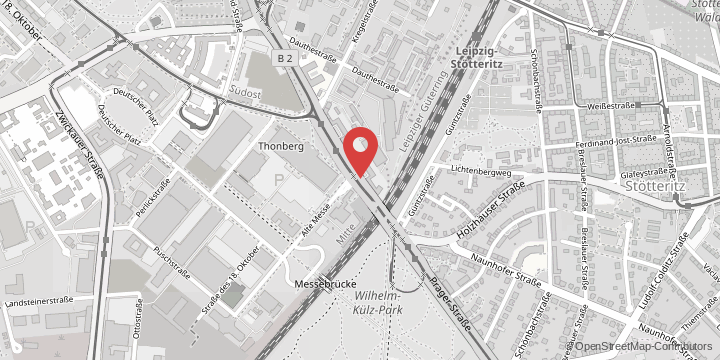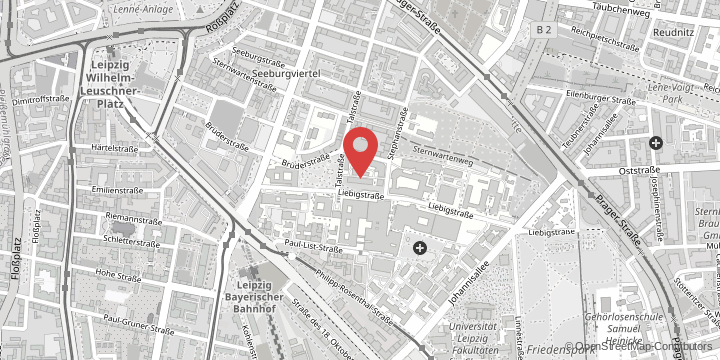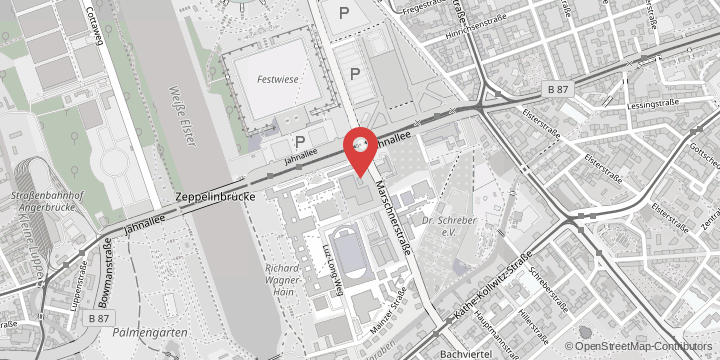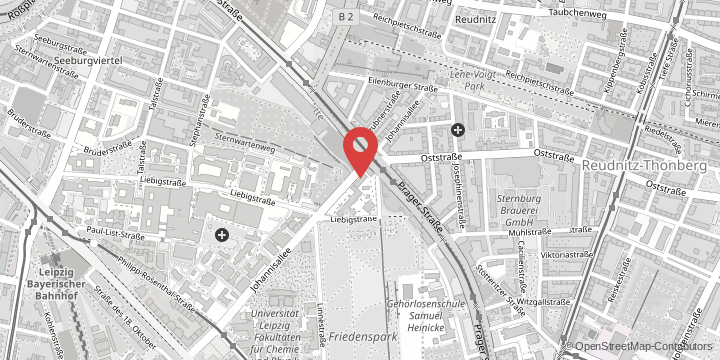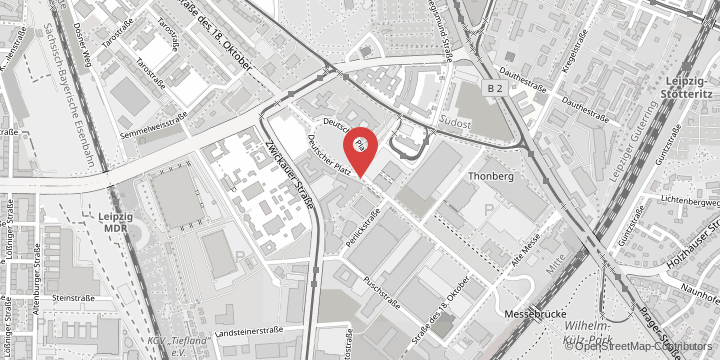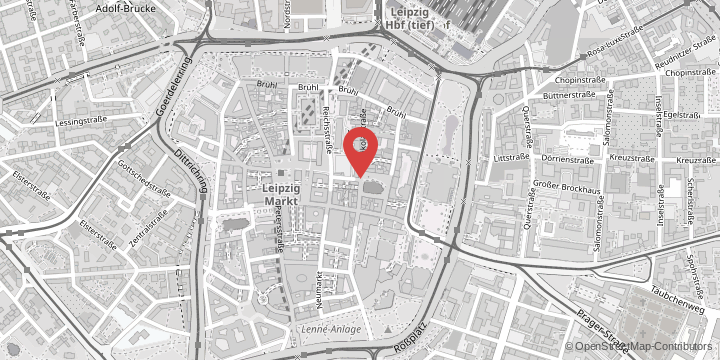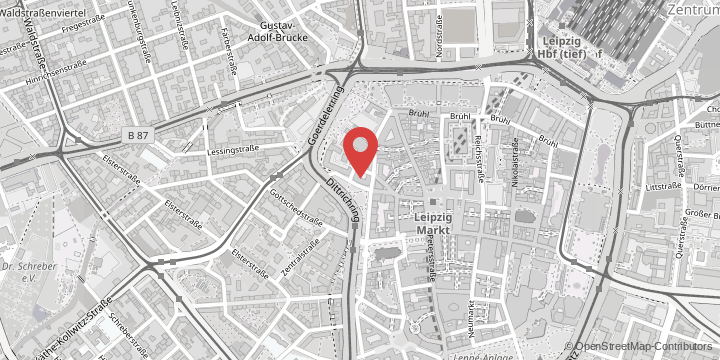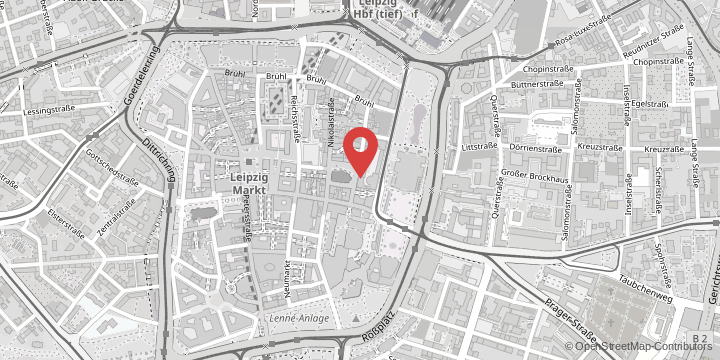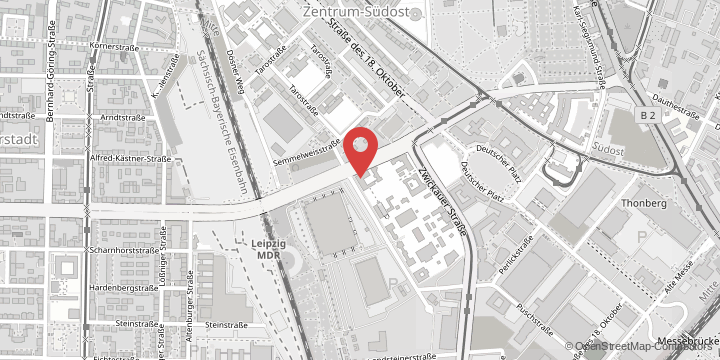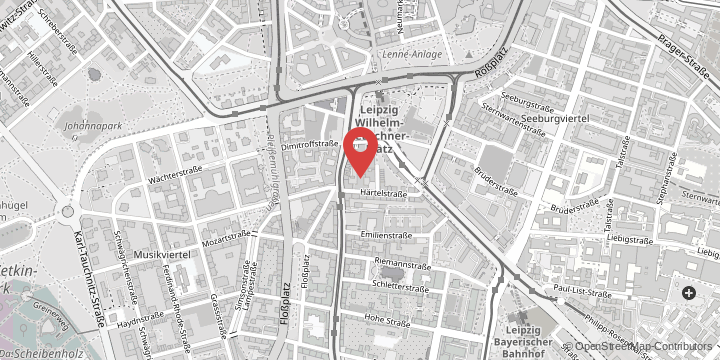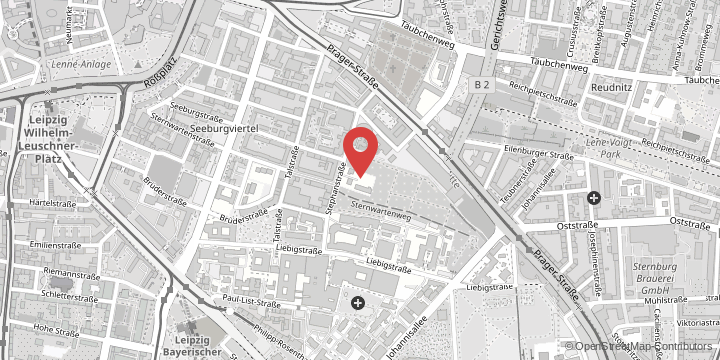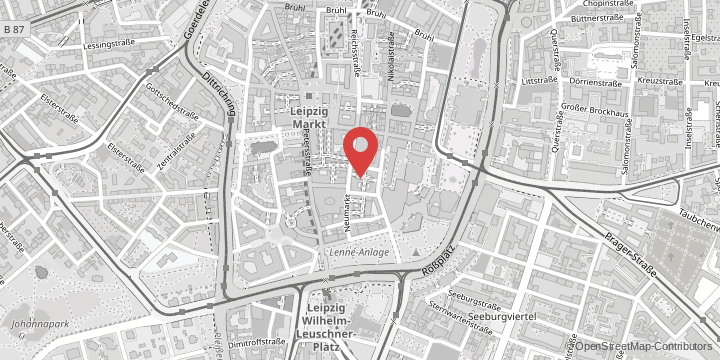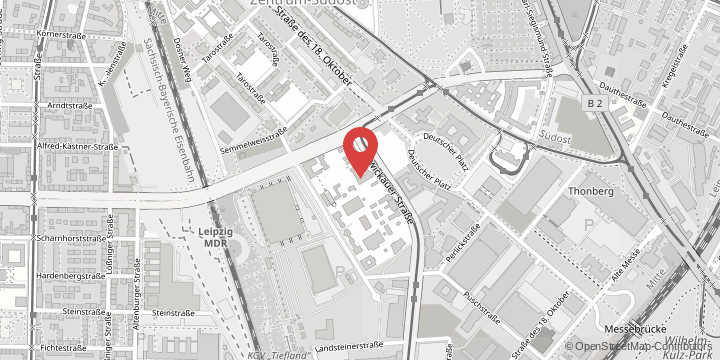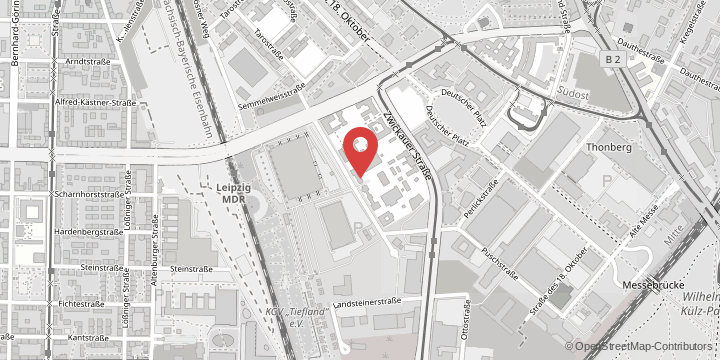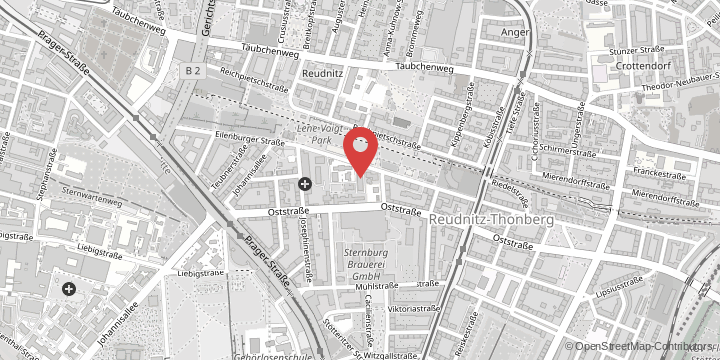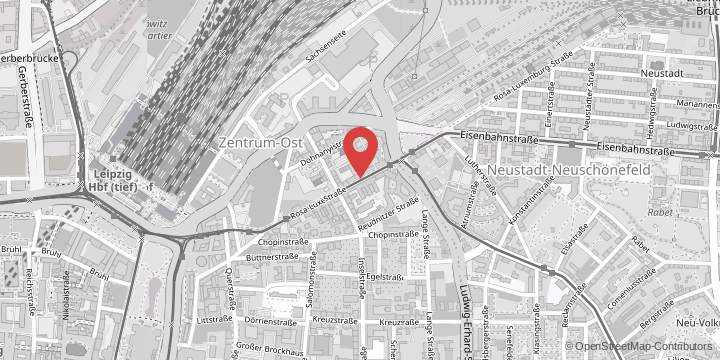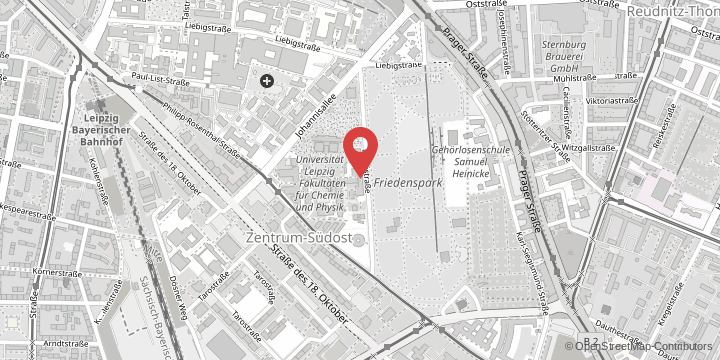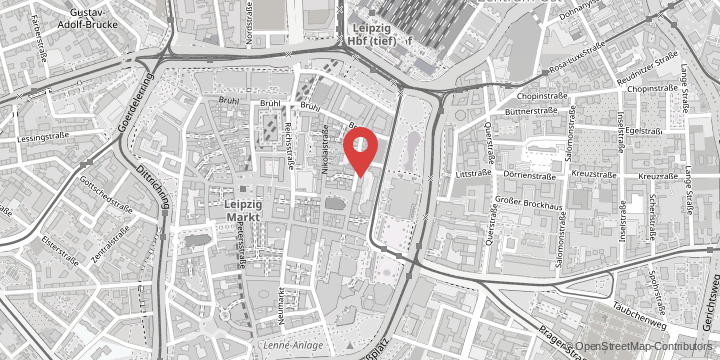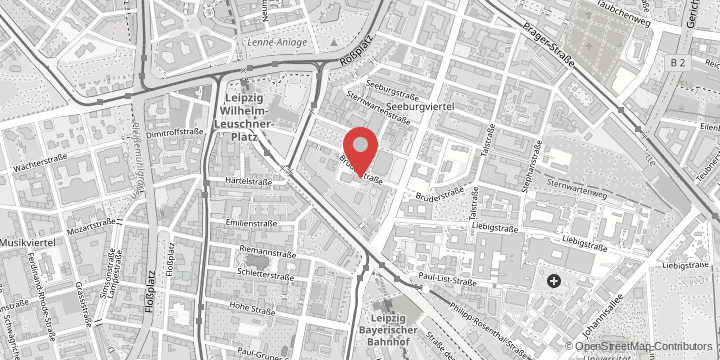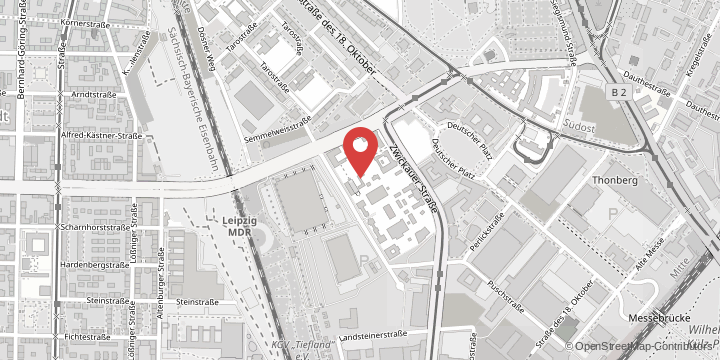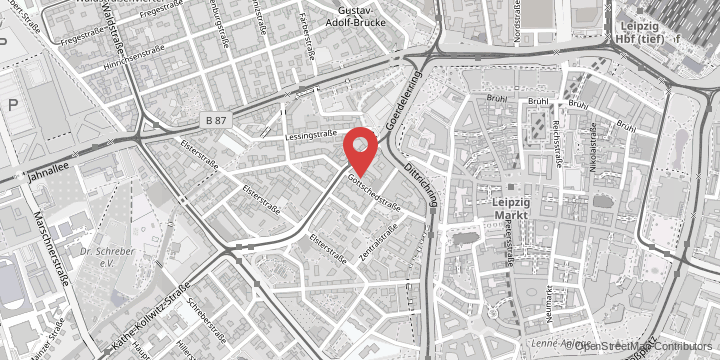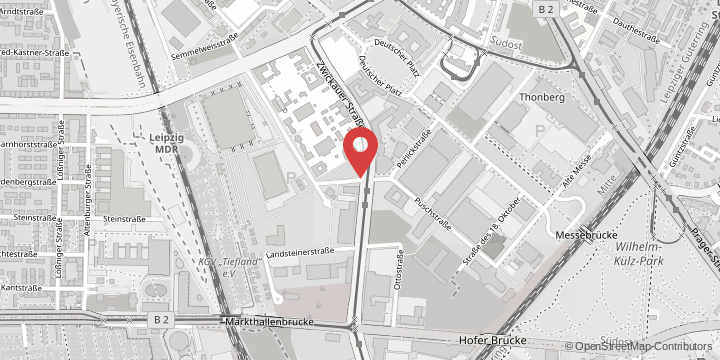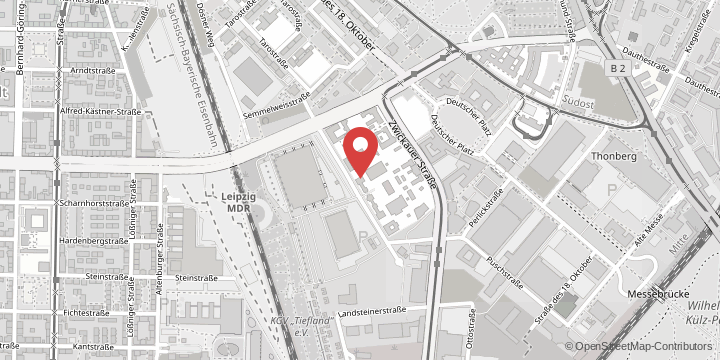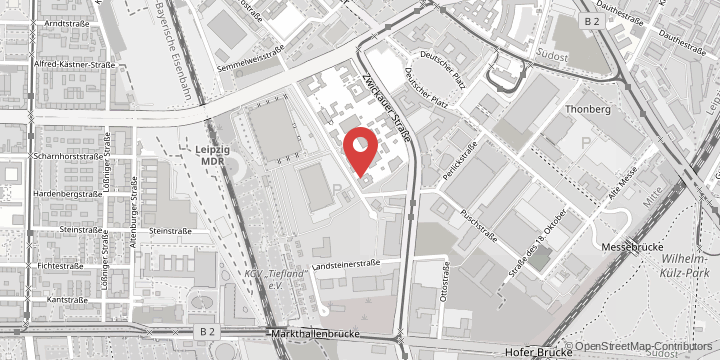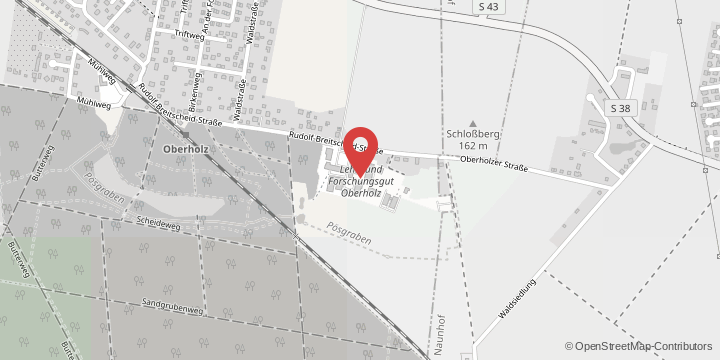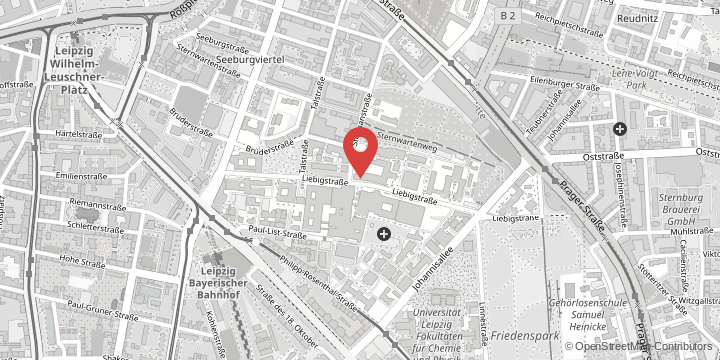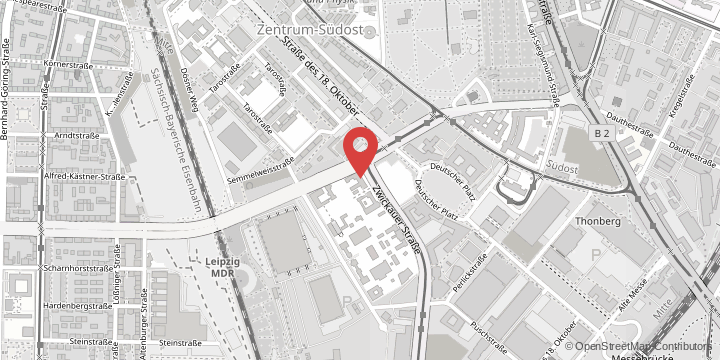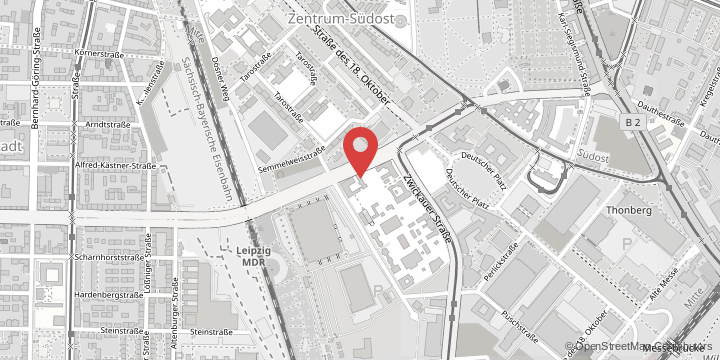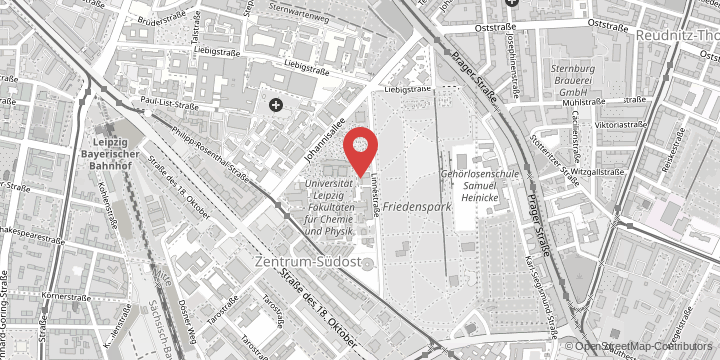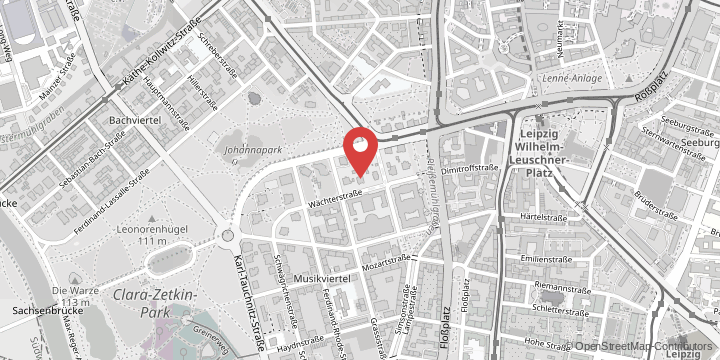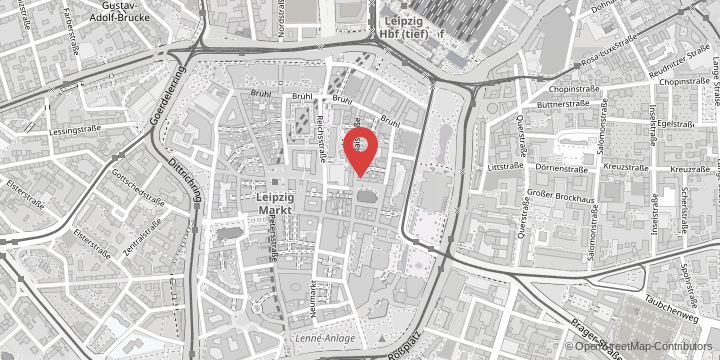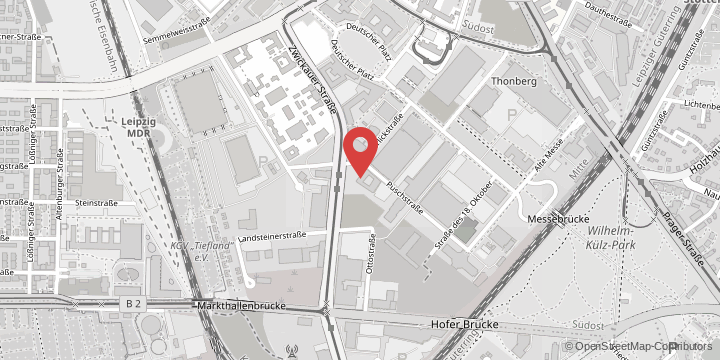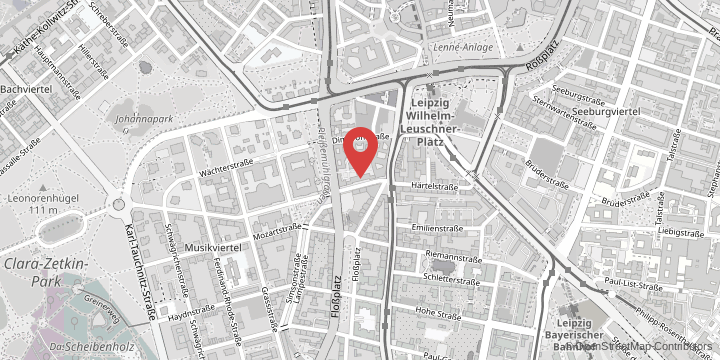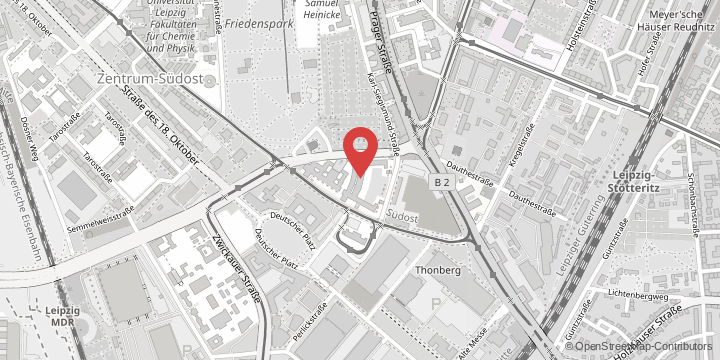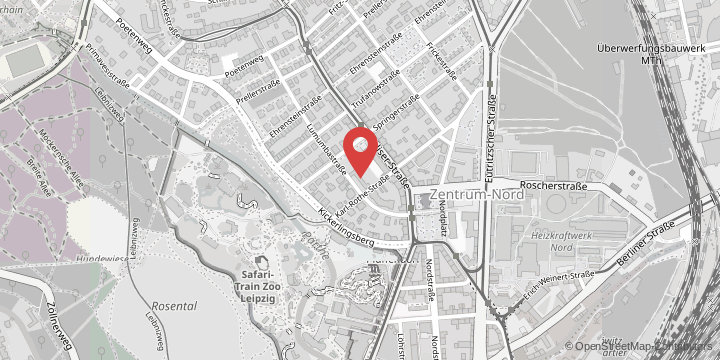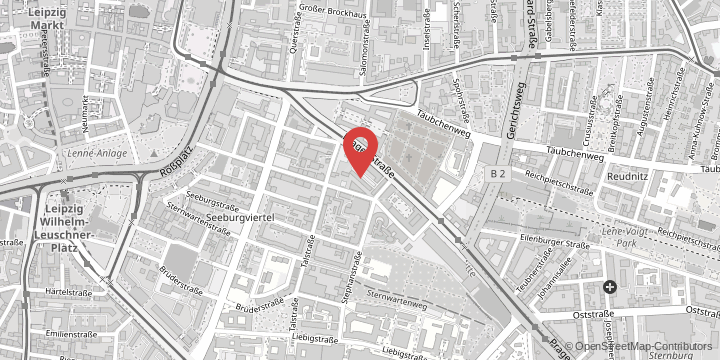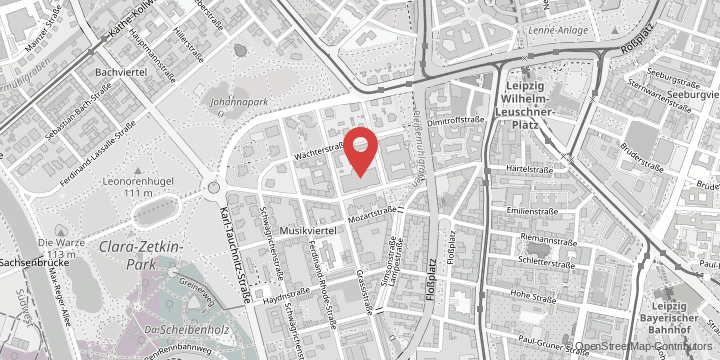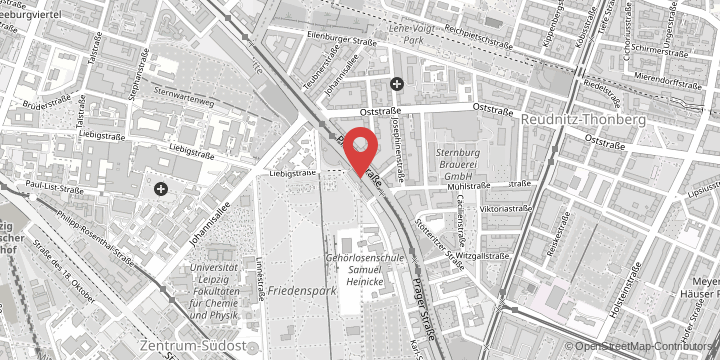"Von März bis Oktober vergangenen Jahres führten Studenten der Moldauischen Staatlichen Universität Chisinau zahlreiche Interviews mit Opfern der stalinistischen Deportationen aus der Moldauischen Sozialistischen Sowjetrepublik im Zeitraum von 1940 bis 1949", berichtet Projektkoordinator Christian-Daniel Strauch vom Institut für Slavistik der Universität Leipzig. Daneben dokumentierten die Studenten Gedenkorte, besuchten Gedenkveranstaltungen anlässlich diesbezüglich relevanter historischer Daten und beschäftigten sich ebenfalls mit der entsprechenden Presseberichterstattung. Studierende der Universität Leipzig reisten im September 2012 nach Chisinau, um dort im Rahmen eines Workshops die Projektergebnisse zu diskutieren sowie im Anschluss in Deutschland aufzubereiten.
Einige der Betroffenen versuchten, die erlebten Schrecken zu vergessen, andere bemühten sich durch verschiedene Aktionen, unter anderem durch das Aufstellen von Mahnmalen, darauf aufmerksam zu machen. "Dieses Thema stellt für die Gesellschaft eine große Herausforderung dar", betonte Strauch. Im Sommer 2009 habe sich die damals regierende Partei der Kommunisten der Republik Moldova geweigert, sich im Parlament an einer von der Opposition vorgeschlagenen Schweigeminute zur Erinnerung an die Opfer der Deportationen zu beteiligen. "Die öffentliche Brisanz der Bewertung dieses Traumas, das in Moldova Politiker und Akademiker wie einfache Bürger spaltet, verleiht der Untersuchung eine starke gesellschaftliche Relevanz", erklärte er weiter. Seit dem Regierungswechsel 2010, als die "Allianz für europäische Integration" die Leitung des jungen Staates übernehmen konnte, haben sich die Rahmenbedingungen für eine öffentliche Würdigung des kollektiven Erinnerns spürbar verbessert. Gleichwohl empfänden viele Betroffene ihre Situation im Hinblick auf Rehabilitation und Entschädigungsleistungen nach wie vor als unbefriedigend.
Das Projekt wurde von der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung, Zukunft" finanziert, die seit mehreren Jahren unter anderem das Förderprogramm "Geschichtswerkstatt Europa" in Kooperation mit dem Global and European Studies Institute (GESI) der Universität Leipzig betreibt. Maßgebliche Unterstützung erhielt das Projekt vom Institut für angewandte Geschichte (Frankfurt/Oder) sowie dem Moldova-Institut Leipzig.